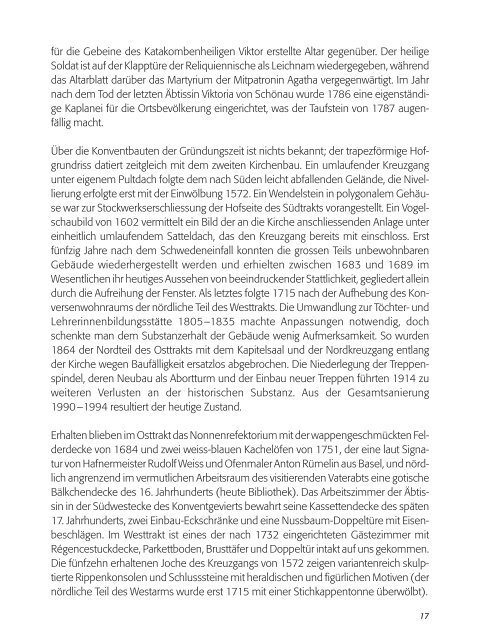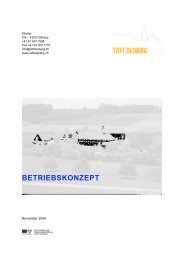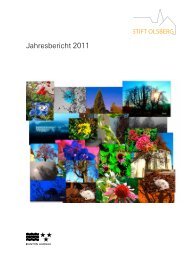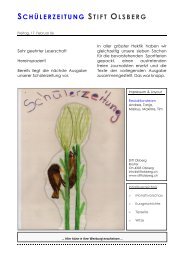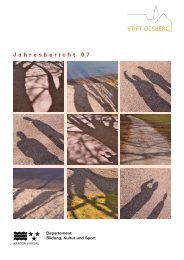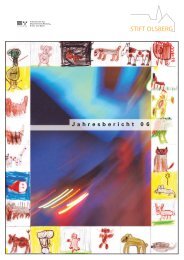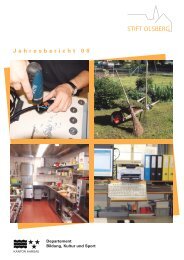150 Jahre Stift Olsberg
150 Jahre Stift Olsberg
150 Jahre Stift Olsberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
für die Gebeine des Katakombenheiligen Viktor erstellte Altar gegenüber. Der heilige<br />
Soldat ist auf der Klapptüre der Reliquiennische als Leichnam wiedergegeben, während<br />
das Altarblatt darüber das Martyrium der Mitpatronin Agatha vergegenwärtigt. Im Jahr<br />
nach dem Tod der letzten Äbtissin Viktoria von Schönau wurde 1786 eine eigenständige<br />
Kaplanei für die Ortsbevölkerung eingerichtet, was der Taufstein von 1787 augenfällig<br />
macht.<br />
Über die Konventbauten der Gründungszeit ist nichts bekannt; der trapezförmige Hofgrundriss<br />
datiert zeitgleich mit dem zweiten Kirchenbau. Ein umlaufender Kreuzgang<br />
unter eigenem Pultdach folgte dem nach Süden leicht abfallenden Gelände, die Nivellierung<br />
erfolgte erst mit der Einwölbung 1572. Ein Wendelstein in polygonalem Gehäuse<br />
war zur Stockwerkserschliessung der Hofseite des Südtrakts vorangestellt. Ein Vogelschaubild<br />
von 1602 vermittelt ein Bild der an die Kirche anschliessenden Anlage unter<br />
einheitlich umlaufendem Satteldach, das den Kreuzgang bereits mit einschloss. Erst<br />
fünfzig <strong>Jahre</strong> nach dem Schwedeneinfall konnten die grossen Teils unbewohnbaren<br />
Gebäude wiederhergestellt werden und erhielten zwischen 1683 und 1689 im<br />
Wesentlichen ihr heutiges Aussehen von beeindruckender Stattlichkeit, gegliedert allein<br />
durch die Aufreihung der Fenster. Als letztes folgte 1715 nach der Aufhebung des Konversenwohnraums<br />
der nördliche Teil des Westtrakts. Die Umwandlung zur Töchter- und<br />
Lehrerinnenbildungsstätte 1805–1835 machte Anpassungen notwendig, doch<br />
schenkte man dem Substanzerhalt der Gebäude wenig Aufmerksamkeit. So wurden<br />
1864 der Nordteil des Osttrakts mit dem Kapitelsaal und der Nordkreuzgang entlang<br />
der Kirche wegen Baufälligkeit ersatzlos abgebrochen. Die Niederlegung der Treppenspindel,<br />
deren Neubau als Abortturm und der Einbau neuer Treppen führten 1914 zu<br />
weiteren Verlusten an der historischen Substanz. Aus der Gesamtsanierung<br />
1990–1994 resultiert der heutige Zustand.<br />
Erhalten blieben im Osttrakt das Nonnenrefektorium mit der wappengeschmückten Felderdecke<br />
von 1684 und zwei weiss-blauen Kachelöfen von 1751, der eine laut Signatur<br />
von Hafnermeister Rudolf Weiss und Ofenmaler Anton Rümelin aus Basel, und nördlich<br />
angrenzend im vermutlichen Arbeitsraum des visitierenden Vaterabts eine gotische<br />
Bälkchendecke des 16. Jahrhunderts (heute Bibliothek). Das Arbeitszimmer der Äbtissin<br />
in der Südwestecke des Konventgevierts bewahrt seine Kassettendecke des späten<br />
17. Jahrhunderts, zwei Einbau-Eckschränke und eine Nussbaum-Doppeltüre mit Eisenbeschlägen.<br />
Im Westtrakt ist eines der nach 1732 eingerichteten Gästezimmer mit<br />
Régence stuckdecke, Parkettboden, Brusttäfer und Doppeltür intakt auf uns gekommen.<br />
Die fünfzehn erhaltenen Joche des Kreuzgangs von 1572 zeigen variantenreich skulptierte<br />
Rippenkonsolen und Schlusssteine mit heraldischen und figürlichen Motiven (der<br />
nördliche Teil des Westarms wurde erst 1715 mit einer Stichkappentonne überwölbt).<br />
17