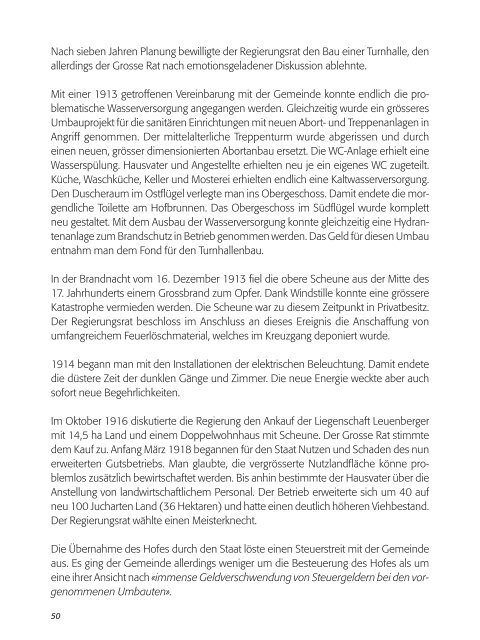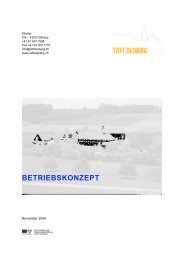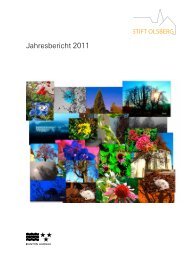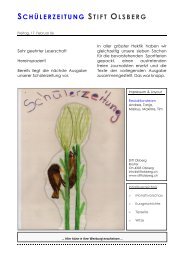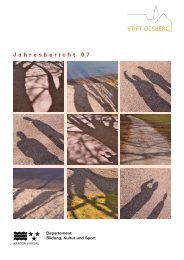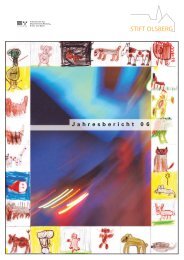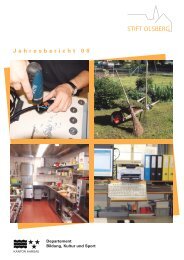150 Jahre Stift Olsberg
150 Jahre Stift Olsberg
150 Jahre Stift Olsberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nach sieben <strong>Jahre</strong>n Planung bewilligte der Regierungsrat den Bau einer Turnhalle, den<br />
allerdings der Grosse Rat nach emotionsgeladener Diskussion ablehnte.<br />
Mit einer 1913 getroffenen Vereinbarung mit der Gemeinde konnte endlich die problematische<br />
Wasserversorgung angegangen werden. Gleichzeitig wurde ein grösseres<br />
Umbauprojekt für die sanitären Einrichtungen mit neuen Abort- und Treppenanlagen in<br />
Angriff genommen. Der mittelalterliche Treppenturm wurde abgerissen und durch<br />
einen neuen, grösser dimensionierten Abortanbau ersetzt. Die WC-Anlage erhielt eine<br />
Wasserspülung. Hausvater und Angestellte erhielten neu je ein eigenes WC zugeteilt.<br />
Küche, Waschküche, Keller und Mosterei erhielten endlich eine Kaltwasserversorgung.<br />
Den Duscheraum im Ostflügel verlegte man ins Obergeschoss. Damit endete die morgendliche<br />
Toilette am Hofbrunnen. Das Obergeschoss im Südflügel wurde komplett<br />
neu gestaltet. Mit dem Ausbau der Wasserversorgung konnte gleichzeitig eine Hydrantenanlage<br />
zum Brandschutz in Betrieb genommen werden. Das Geld für diesen Umbau<br />
entnahm man dem Fond für den Turnhallenbau.<br />
In der Brandnacht vom 16. Dezember 1913 fiel die obere Scheune aus der Mitte des<br />
17. Jahrhunderts einem Grossbrand zum Opfer. Dank Windstille konnte eine grössere<br />
Katastrophe vermieden werden. Die Scheune war zu diesem Zeitpunkt in Privatbesitz.<br />
Der Regierungsrat beschloss im Anschluss an dieses Ereignis die Anschaffung von<br />
umfangreichem Feuerlöschmaterial, welches im Kreuzgang deponiert wurde.<br />
1914 begann man mit den Installationen der elektrischen Beleuchtung. Damit endete<br />
die düstere Zeit der dunklen Gänge und Zimmer. Die neue Energie weckte aber auch<br />
sofort neue Begehrlichkeiten.<br />
Im Oktober 1916 diskutierte die Regierung den Ankauf der Liegenschaft Leuenberger<br />
mit 14,5 ha Land und einem Doppelwohnhaus mit Scheune. Der Grosse Rat stimmte<br />
dem Kauf zu. Anfang März 1918 begannen für den Staat Nutzen und Schaden des nun<br />
erweiterten Gutsbetriebs. Man glaubte, die vergrösserte Nutzlandfläche könne problemlos<br />
zusätzlich bewirtschaftet werden. Bis anhin bestimmte der Hausvater über die<br />
Anstellung von landwirtschaftlichem Personal. Der Betrieb erweiterte sich um 40 auf<br />
neu 100 Jucharten Land (36 Hektaren) und hatte einen deutlich höheren Viehbestand.<br />
Der Regierungsrat wählte einen Meisterknecht.<br />
Die Übernahme des Hofes durch den Staat löste einen Steuerstreit mit der Gemeinde<br />
aus. Es ging der Gemeinde allerdings weniger um die Besteuerung des Hofes als um<br />
eine ihrer Ansicht nach «immense Geldverschwendung von Steuergeldern bei den vorgenommenen<br />
Umbauten».<br />
50