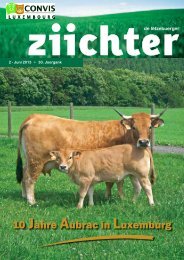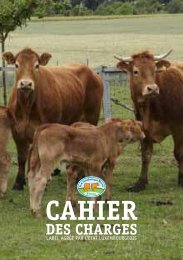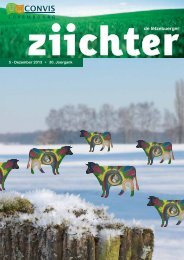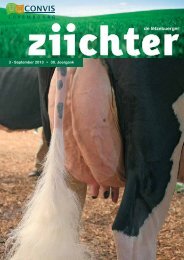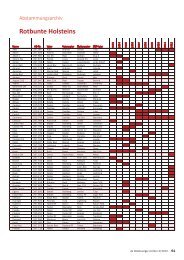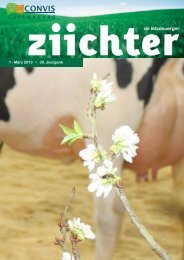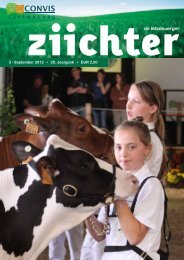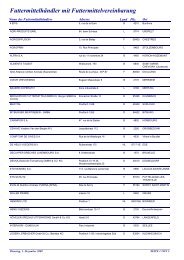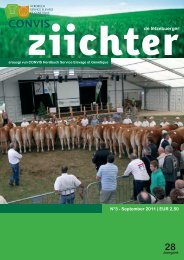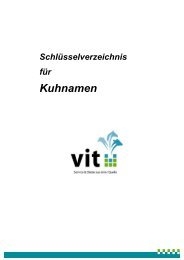de lëtzebuerger ziichter 2/2012 - Convis Herdbuch Service Elevage ...
de lëtzebuerger ziichter 2/2012 - Convis Herdbuch Service Elevage ...
de lëtzebuerger ziichter 2/2012 - Convis Herdbuch Service Elevage ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
seln dargestellt. Bei <strong>de</strong>r IST-Variante mäht<br />
<strong>de</strong>r Landwirt seine Futterbauflächen noch<br />
selber und bringt – ebenfalls in Eigenregie<br />
– das Erntegut mit <strong>de</strong>m La<strong>de</strong>wagen ins<br />
Flachsilo. Die SOLL-Variante ist dadurch<br />
gekennzeichnet, dass die Mäharbeiten<br />
vollständig vom Lohnunternehmer übernommen<br />
wer<strong>de</strong>n. Außer<strong>de</strong>m übernimmt<br />
<strong>de</strong>r Lohnunternehmer das Häckseln <strong>de</strong>s<br />
Erntegutes.<br />
Beim Mähen fallen bei <strong>de</strong>r SOLL-Variante<br />
dadurch lediglich noch administrative Tätigkeiten<br />
an. Die Zeiteinsparung beträgt<br />
mehr als 70 %. Beim Häckseln beträgt die<br />
Zeiteinsparung 1,9 AKh/ha gegenüber<br />
<strong>de</strong>m Verfahren mit La<strong>de</strong>wagen. Dadurch<br />
wird <strong>de</strong>r Arbeitszeitbedarf bei <strong>de</strong>r Ernte<br />
und <strong>de</strong>r Einfuhr um mehr als die Hälfte reduziert.<br />
Verfügbare Feldarbeitstage können<br />
somit besser genutzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Insgesamt fallen bei <strong>de</strong>r Silageernte nunmehr<br />
3,4 AKh/ha (dies entspricht ca. 20<br />
%) weniger an (siehe Abb. 2).<br />
■ Verfahrenstechnische und<br />
arbeitsorganisatorische<br />
Optimierung<br />
Ausgehend von je<strong>de</strong>r Arbeitsplanung erfolgt<br />
auf <strong>de</strong>m mo<strong>de</strong>rnen Landwirtschaftsbetrieb<br />
ebenfalls eine Zeitplanung. Dabei<br />
wird die verfügbare Arbeitszeit aller Mitarbeiten<strong>de</strong>n<br />
systematisch <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen<br />
Aufgabenblöcken zugeteilt. In diesem<br />
Zusammenhang sind die drei folgen<strong>de</strong>n<br />
Fragestellungen im Rahmen von Selbst-<br />
o<strong>de</strong>r Fremdkontrollen zu berücksichtigen:<br />
1. Wie viel Zeit wird für die einzelnen Tätigkeiten<br />
im Tagesverlauf benötigt?<br />
2. Wie wird die verfügbare Zeit optimal<br />
eingesetzt?<br />
3. Wie und wo kann Zeit ohne Qualitätsverlust<br />
eingespart wer<strong>de</strong>n?<br />
Hieraus lassen sich zwei wesentliche Optimierungsmöglichkeiten<br />
ableiten. Die erste<br />
ist die verfahrenstechnische Optimierung.<br />
Sie be<strong>de</strong>utet i.d.R. eine zusätzliche o<strong>de</strong>r<br />
auch verän<strong>de</strong>rte Mechanisierung von<br />
Verfahrensabläufen. Dies ist meist mit ei-<br />
MILCHRINDER 33<br />
Abbildung 2: Arbeitswirtschaftlicher Vergleich von IST- und SOLL-Varianten beim Futterbau<br />
im Rahmen einer Tätigkeits- und Schwachstellenanalyse (RB=Rundballen, QB= Qua<strong>de</strong>rballen,<br />
HD=Hochdruckballen, o.M.= ohne Management).<br />
ner Kostenfolge verbun<strong>de</strong>n und be<strong>de</strong>utet<br />
häufig auch die Abgabe von Tätigkeiten<br />
an Dritte (z.B. Lohnunternehmer o<strong>de</strong>r Maschinenring).<br />
Die Zielvorgabe bei <strong>de</strong>r verfahrenstechnischen<br />
Optimierung besteht<br />
darin, dass <strong>de</strong>r professionelle Landwirt<br />
als Spezialist in seinem Gebiet auftritt.<br />
Der Vorteil dieser Optimierungsform liegt<br />
in <strong>de</strong>r sehr schnellen Zielerreichung.<br />
Die zweite Optimierungsmöglichkeit besteht<br />
aus einer organisatorischen Optimierung<br />
und ist selten mit Kostenfolgen<br />
verbun<strong>de</strong>n. Bei dieser Optimierungsform<br />
wird je<strong>de</strong>s interessieren<strong>de</strong> Arbeitsverfahren<br />
im IST-Zustand in Form einer<br />
Schwachstellenanalyse (siehe oben) hinterfragt<br />
und im ständigen Vergleich mit<br />
SOLL-Vorgaben verbessert. Grundvoraussetzung<br />
sind wie<strong>de</strong>r klare und messbare<br />
Zielsetzungen über Arbeitspläne und<br />
Checklisten. Das Optimierungspotenzial<br />
eines beliebigen Arbeitsverfahrens kann<br />
damit voll ausgeschöpft und die Arbeitszufrie<strong>de</strong>nheit<br />
gesteigert wer<strong>de</strong>n. Grundvoraussetzung<br />
für die organisatorische<br />
Optimierung ist allerdings eine ständige<br />
und gezielte Weiterbildung im gewünschten<br />
Produktionsprozess.<br />
Eine Hilfestellung bei <strong>de</strong>r organisatorischen<br />
Optimierung kann über <strong>de</strong>n sog.<br />
Managementregelkreis gegeben wer<strong>de</strong>n<br />
(siehe Abb. 3). Dieser trägt – ausgehend<br />
von einer Zielsetzung – sowohl bei <strong>de</strong>r<br />
Arbeitsorganisation als auch bei <strong>de</strong>r Zeit-<br />
<strong>de</strong> <strong>lëtzebuerger</strong> <strong>ziichter</strong> 2|<strong>2012</strong>