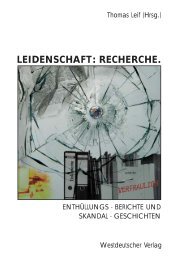Nr. 40/41 - Netzwerk Recherche
Nr. 40/41 - Netzwerk Recherche
Nr. 40/41 - Netzwerk Recherche
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Jahreskonferenz 2008 von <strong>Netzwerk</strong> <strong>Recherche</strong> – READER für Freitag, 13. Juni 2008<br />
Gebührengeldern (für TV-Rechte und, wie die ARD, als Sponsor des Team Telekom) die<br />
Dopingumtriebe mit finanzierten. Wenn sich etwas verändert hat, dann vielleicht dies: Denjenigen<br />
Kollegen, die seit vielen Jahren Missstände anprangern und versuchen, zu recherchieren, werden von<br />
den journalistischen Hierarchen (Chefredaktionen, Intendanten, Ressortleiter) nicht mehr ganz so<br />
mächtige Steine in den Weg gelegt. Doch das ist konjunkturabhängig, soll heißen: Wenn deutsche<br />
Athleten Gold holen oder eben vorn mit radeln, sind journalistische Maßstäbe schnell wieder<br />
vergessen und die Kollegen werden aufgefordert, weniger kritische zu berichten.<br />
2) Ist es legitim, jeden Sportler unter Generalverdacht zu stellen oder gilt hier zunächst immer noch<br />
die Unschuldsvermutung?<br />
Journalisten haben von Berufs/von Amts wegen jede Leistung anzuzweifeln. Ich nenne es nicht<br />
Generalverdacht, sondern eine journalistische Grundregel. Und Unschuldsvermutung ist in diesem<br />
Zusammenhang das absolut falsche Wort. Denn im Sport gilt schon seit Jahren folgende Regel, auf<br />
dem die Dopingaufklärung beruht: Anders als im Strafrecht, wo es eine Unschuldsvermutung gibt, ist<br />
es im Sport so, dass der Athlet, wenn er positiv getestet wird und/oder andere erdrückende Beweise<br />
gegen ihn vorliegen, seine Unschuld selbst nachweisen muss. Es gilt die so genannte<br />
Beweislastumkehr. Ich treibe die Argumentation mit der Beweislastumkehr so weit, zu sagen: Da der<br />
olympische Hochleistungssport zum überwiegenden Teil aus Steuermitteln finanziert wird, ist der<br />
Athlet, sind die Sportverbände, immer in der Pflicht, ihre Sauberkeit nachzuweisen. Sie haben in jeder<br />
Beziehung Transparenz herzustellen. Der Steuerzahler sollte beispielsweise ein Anrecht darauf<br />
haben, jederzeit die Dopingkontrolldaten jedes deutschen, mit öffentlichen Mitteln alimentierten<br />
Spitzensportlers einzusehen. In der Praxis aber dominiert noch immer die Intransparenz, nach<br />
demokratischen Grundsätzen befinden wir uns teilweise noch in der Steinzeit.<br />
3) Wo ist die Grenze zwischen gesundem Misstrauen und einem Mindestmaß an Vertrauen?<br />
Diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten, sondern nur aus der Summe vieler Faktoren.<br />
Beispielsweise dem in der vorherigen Antwort skizzierten Transparenzgebot. Ist diese Transparenz<br />
gewährleistet, kann sich auch Vertrauen aufbauen.<br />
4) Inwieweit gehört es beispielsweise zu den <strong>Recherche</strong>routinen, bei Siegen und Rekorden zunächst<br />
zu überprüfen, ob eine Leistung ohne unerlaubte Hilfsmittel realistisch war (etwa nach Erkrankungen<br />
von Sportlern)?<br />
Das hat schon immer zu den <strong>Recherche</strong>routinen gehört. Schon immer aber wurden jene Kollegen, die<br />
auf märchenhafte Leistungsentwicklungen hinwiesen (etwa 1993/94 bei chinesischen Läuferinnen und<br />
Schwimmerinnen, 1996 bei der Schwimmerin Michelle Smith de Bruin 2000 beim griechischen<br />
Sprinter Kenteris) von anderen so genannten Journalisten als Kritikaster und Nestbeschmutzer<br />
gebrandmarkt. Die Frage nach der Erkrankung von Sportlern müsste präzisiert werden. Denn auch<br />
hier kann ja nur das Transparenzgebot gelten. Wenn eine solche (angebliche) Erkrankung, die diese<br />
oder jene Mittel-Einnahme erlaubt, nicht transparent gemacht wird, hat auch kaum jemand eine<br />
Chance, darüber sauber zu urteilen. Im Gegenteil, derartige Angaben werden top secret verhandelt.<br />
Zwei Beispiele: In manchen Nationen ist nahezu jeder olympische Spitzenschwimmer (angeblich)<br />
asthmakrank. Jan Ullrich ist ebenfalls angeblich asthmakrank gewesen, und zwar in einem Maße, in<br />
dem Normalbürger als schwerbehindert eingestuft werden würden. Der arg kranke Ullrich aber ist<br />
Alpenpässe hochgejagt wie ein junger Gott - ein gedopter Gott, wie wir wissen.<br />
5) Welchen Einfluss haben Sportjournalisten auf Moral und Selbstkritik innerhalb des Sports selbst?<br />
Natürlich einen großen Einfluss. Ich behaupte: Nur durch den beharrlichen Einsatz weniger<br />
Journalisten und weniger unabhängiger Wissenschaftler, die über Jahrzehnte um jedes Quäntchen<br />
Öffentlichkeit gekämpft haben, ist die Doping-Branche so in die Bredouille gekommen. Ich denke<br />
sogar, ich kann diese These belegen. Fakt ist leider auch: Es sind sicher weniger als zehn Prozent der<br />
Sportjournalisten ihrer Verpflichtung nachgekommen, Öffentlichkeit herzustellen, wo immer es ihnen<br />
möglich war.<br />
11


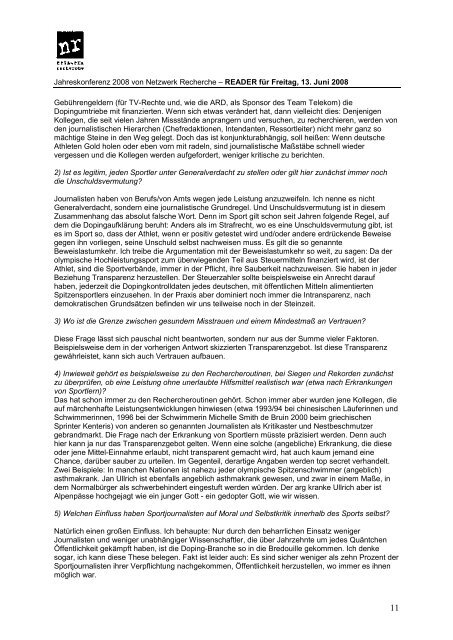
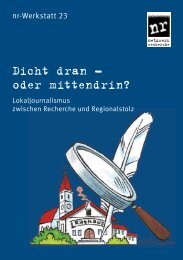
![Kurzbiografien der Referenten und ihre Themen [PDF] - Netzwerk ...](https://img.yumpu.com/21354886/1/184x260/kurzbiografien-der-referenten-und-ihre-themen-pdf-netzwerk-.jpg?quality=85)

![Rede Frank A. Meyer [PDF] - Netzwerk Recherche](https://img.yumpu.com/21238543/1/184x260/rede-frank-a-meyer-pdf-netzwerk-recherche.jpg?quality=85)
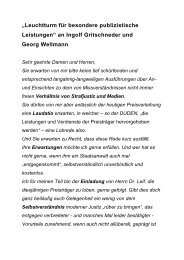


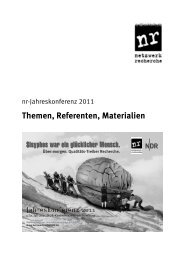


![Die stille Macht [Text] (381 S., 2.142 - Netzwerk Recherche](https://img.yumpu.com/7467581/1/184x260/die-stille-macht-text-381-s-2142-netzwerk-recherche.jpg?quality=85)