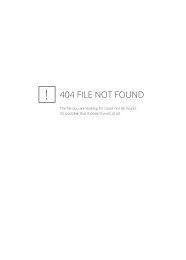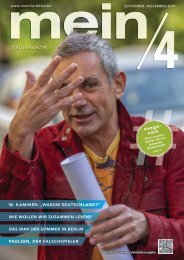Mein/4 Stadtmagazin Berlin 3/2021
Mein/4 Stadtmagazin Berlin, Ausgabe Dezember 2020
Mein/4 Stadtmagazin Berlin, Ausgabe Dezember 2020
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kultur im Kiez
Scheibenhochhaus von
Oscar Niemeyer
mein/4
war. Bereits während der Erschließung
wurde das Viadukt der Stadtbahn durch
das Wohngebiet gezogen, das dadurch
in zwei fast gleich große Hälften zerfiel,
jedoch durch zahlreiche Unterführungen
miteinander verbunden blieb. Zur
Jahrhundertwende hatte das Hansaviertel
knapp 18.000 Einwohner, hier
lebten überwiegend „anspruchsvolle
Leute“, neben Bankiers, Staatsbeamten
und Kaufleuten auch zahlreiche
Künstlerinnen und Künstler wie die
Schriftstellerinnen Alice Berend und
Else Lasker-Schüler, die Maler Lovis
Corinth und Walter Leistikow, der Bildhauer
Hugo Lederer, der Theatermacher
Max Reinhardt und der Kritiker Alfred
Kerr. Käthe Kollwitz hatte hier ihr Atelier,
Rosa Luxemburg nahm im Hansaviertel
für wenige Monate Quartier,
ebenso Wladimir Iljitsch Lenin.
Bemerkenswert war der Anteil der jüdischen
Bevölkerung. In den 1920er-
Jahren soll er mit acht Prozent doppelt
so hoch gewesen sein wie im Gesamtdurchschnitt
Berlins. Im Hansaviertel
entstanden neben einer evangelischen
und einer katholischen Kirche folgerichtig
auch zwei Synagogen. Diese wurden
in der Reichsprogromnacht am 9. November
1938 zerstört, mit der „Entjudung“
erlosch 1941 das jüdische Leben
hier vollständig. Heute erinnern knapp
150 Stolpersteine an die deportierten
und ermordeten Bewohnerinnen und Bewohner.
In der Nacht vom 22. auf den
23. November 1943 zerstörte die alliierte
Luftwache einen Großteil des Hansaviertels,
nur 70 der 343 Wohnbauten überstanden
den Krieg, die meisten davon
schwer beschädigt. Im nördlichen Teil des
Hansaviertels lässt sich heute noch das
Mondäne des einstigen Viertels erahnen,
zum Beispiel, wenn man am Holsteiner
Ufer entlang flaniert und die schmuckvoll
gestalteten Fassaden betrachtet. An
der Ecke zur Bartningallee findet man
in einem der wiedererrichteten Gebäude
die – nach eigenen Angaben – älteste
Konditorei Berlins, die in fünfter Generation
betrieben wird. 1852 hatte Gustav
Buchwald, der 1883 offiziell zum königlich-preußischen
Hoflieferanten ernannt
wurde, in Cottbus die nach ihm
benannte Baumkuchenfabrikation mit
Konditorei und Café eröffnet, sein Sohn
erwarb das Haus mit Spreeblick um die
Jahrhundertwende.
Während man nördlich der S-Bahn-Viadukte
also noch ein wenig dem kaiserlichen
Hansaviertel nachspüren kann, ist
dies im südlichen Teil unmöglich, lediglich
zwei Wohnhäuser sind in unmittelbarer
Nähe des S-Bahnhofs Tiergarten
erhalten. Das Hansaviertel galt in der
Nachkriegszeit als größtes innerstädtisches
Trümmergebiet. Als der Bezirk
Tiergarten 1951 mit Baumaßnahmen beginnen
wollte, verhängte der Senat einen
Baustopp, um Westberlin mit einer
großen deutschen Bauausstellung ins
Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit
zu rücken. Das Bauprojekt sollte
einen ideologischen Gegenentwurf zum
„falschen Prunk der Stalinallee“ darstellen,
deren repräsentative, an sowjetischer
Monumentalarchitektur orientierte
Bauten zu dieser Zeit in Ostberlin als
ästhetische und politische Versinnbildlichung
der Leistungsfähigkeit des sozialistischen
Systems entstanden.
1955 wurde nach langwierigen Verhandlungen
ein luftiger Bebauungsplan als
„klares Bekenntnis zur westlichen Welt“
verabschiedet. Die Interbau, die Internationale
Bauaustellung 1957, bildete den
organisatorischen Rahmen des Großbauprojekts,
das jeweils sechs Punkt- und
15
Eternithaus von
Paul Baumgarten
Scheibenhochhaus von
Egon Eiermann (links)
und Punkthochhaus von
Broek & Bakema
Skulptur ohne Titel
von Hans Uhlmann