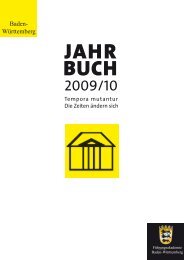JAHR BUCH - Führungsakademie Baden-Württemberg - BW21
JAHR BUCH - Führungsakademie Baden-Württemberg - BW21
JAHR BUCH - Führungsakademie Baden-Württemberg - BW21
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DR. SIEGFRIED MAUCH<br />
Können Kompetenzen übertragen werden?<br />
Die demografische Entwicklung wird in den<br />
nächsten Jahren zu einem Braindrain führen,<br />
der – so die Befürchtung – nur in Ansätzen<br />
durch eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit,<br />
durch Personaleinstellungen oder organisatorische<br />
Maßnahmen ausgeglichen werden<br />
kann. Derzeit liegt das Durchschnittsalter der<br />
im öffentlichen Dienst in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong><br />
Beschäftigten bei rund 50 Jahren. Bis 2020<br />
werden in einzelnen Behörden oder ganzen<br />
Ressorts bis zu zwei Drittel der Beschäftigten<br />
in den Ruhestand gehen. Ob entsprechende<br />
Nachbesetzungen erfolgen, ist offen, da die<br />
ebenfalls angespannte Haushaltslage regelmäßig<br />
über Personaleinsparungen gegenfinanziert<br />
wird. Hinzu kommt, dass auch die<br />
Privatwirtschaft unter den demografischen<br />
Folgen leidet. Im Wettbewerb um Fachkräfte<br />
kann sie leider bessere Konditionen anbieten<br />
als der öffentliche Dienst. Daher liegt die<br />
Überlegung nahe, das zu bewahren, was an<br />
Wissen und Fähigkeiten aufgebaut wurde,<br />
um Aufwendungen einsparen und für Handlungskontinuität<br />
sorgen zu können. Diesem<br />
Ansatz liegt die Vorstellung zu Grunde, dass<br />
die Kompetenz eines Bediensteten wie ein<br />
Objekt erfasst, archiviert und wiederverwendet<br />
werden kann.<br />
Bis vor einigen Jahrzehnten war das vielleicht<br />
noch möglich. Den Bediensteten reichten ihr<br />
Fach- und Dienstwissen aus, um Vorgänge<br />
zufriedenstellend bearbeiten zu können. Das<br />
Fachwissen erwarben sie mit der Ausbildung,<br />
das Dienstwissen über die Aktenlage und<br />
den Dienstverkehr. Daraus leitete Max Weber<br />
die Überlegenheit einer bürokratischen<br />
Verwaltung ab. Diese Vorstellung fand ihr<br />
Ende, als sich die Rolle der Verwaltung in der<br />
Gesellschaft veränderte und Verwaltung nicht<br />
mehr nur Vollstrecker staatlicher Gewalt war,<br />
sondern immer mehr auch eine gesellschaftsgestaltende<br />
Rolle einnahm. Damit wurden<br />
die Beziehungen zwischen Verwaltung und<br />
Gesellschaft dynamischer. Verwaltungshandeln<br />
ließ sich immer weniger mit der Floskel<br />
begründen: Das haben wir schon immer so<br />
gemacht. Um die Dynamik und Komplexität<br />
der Lebenslagen sowie die Unsicherheit von<br />
Umfeldentwicklungen bewältigen und dabei<br />
sowohl richtig als auch gerecht und wirtschaftlich<br />
entscheiden zu können, änderte sich das<br />
Organisations- und Personalprofil sowie das<br />
Entscheidungsverhalten. Die Leistungserbringung<br />
wurde spezifiziert, Zuständigkeiten und<br />
Verantwortung wurden delegiert sowie Organisationen<br />
fragmentiert. Verstärkt sollen auch<br />
die Wirkungen administrativen Handelns erfasst<br />
und zur Steuerungsgrundlage gemacht<br />
werden. Entscheidungen wurden und werden<br />
in immer kürzerer Zeit getroffen.<br />
Infolge dieser Entwicklung vermehrte sich<br />
nicht nur das für Entscheidungen notwendige<br />
Wissen, sondern es änderte sich auch<br />
die Art der Wissensbestände. Das juristische<br />
Wissen wurde um das Wissen weiterer Fachdisziplinen<br />
ergänzt. Neben das Wissen und<br />
die Fähigkeit zur rechtlichen Gestaltung traten<br />
verstärkt managerielles Wissen und managerielle<br />
Fähigkeiten. Das für Problemlösungen<br />
erforderliche Wissen musste entlang der Problemlösungsprozesse<br />
generiert und gepflegt<br />
werden. Die Zeit, dass eine Person, der eine<br />
bestimmte Kompetenz zugewiesen worden<br />
war, damit gleichzeitig auch kompetent wird,<br />
war angesichts der erwachsenen Vielfalt endgültig<br />
vorbei. Das Ausbildungswissen reichte<br />
nicht mehr aus, um zufriedenstellend die zugewiesenen<br />
Aufgaben erfüllen zu können.<br />
Neue und vor allen Dingen methodische und<br />
soziale Anforderungen entstanden. Konstante<br />
Fortbildung war erforderlich. Infolge der Komplexität<br />
gesellschaftlicher Entwicklung und der<br />
Öffnung des Staates in Richtung Bürger konnte<br />
dieser Wissens- und Bildungsbedarf nicht<br />
mehr ausschließlich fremdgesteuert bedient<br />
werden. Zu vielfältig wurden die Lernszenarien<br />
und zu unterschiedlich die Lernformen und<br />
Lernwege. Daher öffnete sich auch die Verwaltung<br />
– wenn auch zögerlich – dem Postulat des<br />
selbstverantwortlichen lebenslangen Lernens,<br />
Lernen nicht mehr nur als Bringschuld der Organisation<br />
anzusehen, sondern als Holschuld<br />
des einzelnen Bediensteten unter Verwendung<br />
eines breiten Repertoires an formellen<br />
und informellen Lernmöglichkeiten zu betrachten.<br />
Da Staat und Verwaltung heute nicht<br />
mehr über das notwendige Wissen verfügen,<br />
um eine sachadäquate Entscheidung treffen<br />
zu können, müssen sie die dafür notwendigen<br />
Lernprozesse selbst organisieren und dabei<br />
ständig selbst lernen, wozu auch entsprechendes<br />
Wissen gehört.<br />
Infolge dieser Entwicklung individualisierten<br />
sich Wissen und Fähigkeiten immer mehr.<br />
Personengebundenes Erfahrungswissen<br />
wurde für Problemlösungen immer wichtiger.<br />
Dokumentenwissen im Sinne von Fach-<br />
und Dienstwissen reicht für Problemlösungen<br />
immer weniger aus. Daher soll dieser<br />
Erfahrungsschatz angesichts der demografischen<br />
Betroffenheit gesichert werden. Dabei<br />
lässt man sich von der Vorstellung leiten,<br />
das Wissen in den Köpfen wie ein Objekt behandeln<br />
zu können, in dem man es erfasst,<br />
archiviert und damit künftigen Generationen<br />
zur Nutzung zur Verfügung stellt.<br />
Bei dieser objektivierten Sicht werden die<br />
Spezifika von Wissen und Kompetenz vernachlässigt.<br />
Wissen entsteht immer in bestimmten<br />
Zusammenhängen und ist an diese<br />
gebunden. Erst die persönliche Erfahrung<br />
in einem bestimmten Kontext bewirkt, dass<br />
aus Information Wissen wird. Infolge der<br />
Spezialisierung und Dezentralisierung der<br />
Aufgabenstellungen bewegt sich nahezu<br />
jeder potenzielle Wissensempfänger regelmäßig<br />
in anderen Kontexten. Sofern keine<br />
gemeinsame Kontexterfahrung vorliegt, die<br />
zudem in einen bestimmten historischen<br />
Bezug eingebunden ist, haben die potenziellen<br />
Wissensempfänger Probleme, sowohl<br />
die Problemstellung als auch die darauf aufbauende<br />
Lösung zu verstehen. Es fehlt Ihnen<br />
das Problembewusstsein.<br />
Selbst dann, wenn man davon ausgeht, dass<br />
ein gemeinsames Verständnis vorliegt, führt<br />
der Wissenstransfer, auch wenn er mit Hilfe<br />
von Storytelling, Wissensstafetten oder<br />
Lessons-Learned-Ansätzen aufbereitet oder<br />
über eine elektronisch verfügbare Wissenslandkarte<br />
ansprechend dargestellt wird,<br />
nicht zwingend auch zu einem Kompetenztransfer.<br />
Denn im Unterschied zum Wissen<br />
zeichnet sich die Kompetenz einer Person<br />
nicht nur durch ihre Kenntnisse, Fähigkeiten<br />
und Erfahrungen, sondern vor allem durch ihr<br />
Problemlösungsverhalten, eine individuelle<br />
persönliche Disposition und eine bestimmte<br />
Werthaltung aus. Eine kompetente Person<br />
kennzeichnet vor allem, dass sie sich in offenen<br />
und unüberschaubaren, komplexen und<br />
50 51