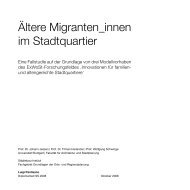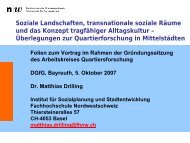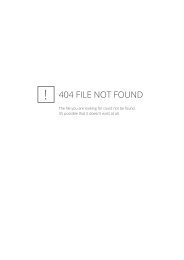Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
on von Gr<strong>und</strong>eigentum in fiktives Kapital <strong>und</strong> die damit möglich werdende Gr<strong>und</strong>stücksspekulation,<br />
zu analysieren, mit einem zusätzlichen Fokus auf <strong>der</strong> kulturellen o<strong>der</strong> symbolischen<br />
Aufwertung von Stadtquartieren im Zusammenhang mit Gentrifizierungsprozessen.<br />
Danach geht es um die beson<strong>der</strong>e physische <strong>und</strong> die daraus resultierende beson<strong>der</strong>e <strong>ökonomische</strong><br />
Qualität von Immobilien <strong>und</strong> <strong>Immobilienmärkte</strong>n <strong>und</strong> ihre Auswirkungen auf den<br />
Akkumulationsprozess von Kapital, die hier vorrangig unter dem Aspekt <strong>der</strong> Umlaufgeschwindigkeit<br />
des Kapitals untersucht wird. Zudem wird die sich wandelnde Qualität von<br />
<strong>Immobilienmärkte</strong>n im Zuge eines gesamtgesellschaftlichen Bedeutungsgewinns <strong>der</strong> Finanzindustrie<br />
untersucht. Abschließend wird die Zyklizität von Immobilienboom- <strong>und</strong> Immobilienkrise<br />
dargestellt. Soweit es möglich ist, verbleibt dieses Kapitel auf <strong>der</strong> skalaren<br />
Ebene einzelner Städte <strong>und</strong> deutet Verbindungen zur Weltwirtschaft nur an.<br />
3.1 SUBJEKTIVE VS. OBJEKTIVE WERTTHEORIE<br />
Auf den ersten Blick erscheint es verblüffend, dass sich in gängigen deutschen Einführungen<br />
in die Wirtschafts- o<strong>der</strong> Stadtgeografie keine allgemeine Theorie <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>rente findet<br />
(z.B. Schätzl 1998, 2000, 1994, Bathelt / Glückler 2003, Kulke 2004, Hofmeister 1994,<br />
Lichtenberger 1998). So wäre doch anzunehmen, dass es die vornehmliche Aufgabe <strong>der</strong><br />
Geografie als Wissenschaft vom Raum wäre, sich Rechenschaft abzulegen über die Beson<strong>der</strong>heiten<br />
<strong>der</strong> Ware Boden in unterschiedlichen gesellschaftlichen Formationen <strong>und</strong> in kapitalistischen<br />
Gesellschaften im Beson<strong>der</strong>en. Zumindest eine allgemeine Theorie darüber,<br />
wie Boden einen Preis bekommen kann, wäre zu erwarten. Statt dessen übergeht die Geografie<br />
dieses Problem für gewöhnlich <strong>und</strong> beginnt unmittelbar mit Standorttheorien, etwa<br />
v. Thünens landwirtschaftlicher Standorttheorie, Alfred Webers industrieller Standorttheorie<br />
o<strong>der</strong> Alonsos städtischer Standorttheorie, um einige maßgebliche Klassiker zu nennen.<br />
Sie befasst sich also mit <strong>der</strong> <strong>ökonomische</strong>n Steuerung von Landnutzungen, ohne eine vorgeordnete<br />
Theorie <strong>der</strong> Bodenpreisbildung <strong>und</strong> das bedeutet, ohne die <strong>ökonomische</strong> Beson<strong>der</strong>heit<br />
des Bodens in kapitalistischen Gesellschaften zu untersuchen.<br />
Auf den zweiten Blick wird diese Leerstelle <strong>der</strong> hegemonialen theoretischen Strömungen<br />
in <strong>der</strong> Geografie aber logisch ableitbar. Denn diese Strömungen stehen auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage<br />
<strong>der</strong> subjektiven Werttheorie. Die subjektive Werttheorie löst aber das in <strong>der</strong> klassischen Politischen<br />
Ökonomie bereits existierende <strong>und</strong> durch Adam Smith popularisierte Wertparadoxon<br />
– die Abweichung des Preises einer Ware, bzw. ihres Nutzens von ihrem Wert –<br />
dadurch, dass sie die Preisbildung insgesamt den Resultaten <strong>der</strong> subjektiven Entscheidungen<br />
<strong>der</strong> Wirtschaftssubjekte zuschreibt <strong>und</strong> die Kategorie eines vom Preis eventuell abweichenden<br />
Wertes einer Ware einfach aufgibt. Für sie existiert das Wertparadoxon durch diesen<br />
Kunstgriff daher nicht mehr.<br />
Der Preis aller Waren wird in <strong>der</strong> subjektiven Werttheorie bestimmt durch das Verhältnis<br />
von Angebot <strong>und</strong> Nachfrage (Blum 2004, 142ff). Sind Angebot <strong>und</strong> Nachfrage ausgeglichen,<br />
d.h. trifft eine Menge an Waren auf eine gleich große Menge an zahlungsfähigem Bedürfnis<br />
nach diesen Waren, dann ergibt sich <strong>der</strong> so genannte Gleichgewichtspreis. Bei einem<br />
Angebotsüberhang ergibt sich eine Konkurrenz <strong>der</strong> Verkäufer, die die Machtposition<br />
<strong>der</strong> Käufer stärkt, es wird von einem Käufermarkt gesprochen. Der umgekehrte Fall wird<br />
als Verkäufermarkt bezeichnet. Boden ist innerhalb dieses theoretischen Rahmens zwar einer<br />
von drei distinkten Produktionsfaktoren, Boden 11 , Arbeit <strong>und</strong> Kapital <strong>und</strong> er hat beson<strong>der</strong>e<br />
physische Qualitäten, die für Produktions- <strong>und</strong> Konsumptionsprozess relevant sein<br />
können <strong>und</strong> in <strong>der</strong> Geografie sind Boden, Raum <strong>und</strong> Standort natürlich ganz zentrale Kategorien.<br />
Die Bildung eines Preises für Boden, also seine <strong>ökonomische</strong> Qualität, ist aber innerhalb<br />
<strong>der</strong> subjektiven Werttheorie im Allgemeinen nichts Beson<strong>der</strong>es <strong>und</strong> wird ebenfalls<br />
11 Boden wird teilweise erweitert zu „Umwelt“ im Allgemeinen, z.B. Blum 2004, 88ff.<br />
19



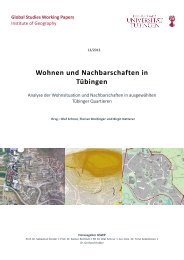




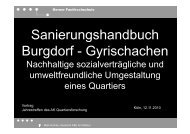


![Wohnen als soziale Kulturtechnik [â¦] (Stephanie Weiss)](https://img.yumpu.com/25621405/1/190x135/wohnen-als-soziale-kulturtechnik-a-stephanie-weiss.jpg?quality=85)