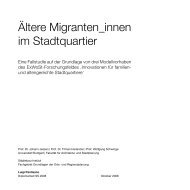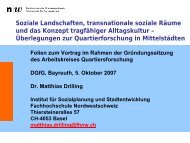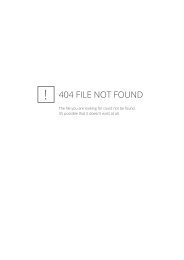Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zierung durchzuführen <strong>und</strong> ordnen dabei den drei von ihnen unterschiedenen Wellen <strong>der</strong><br />
Gentrifizierung jeweils eine grobe Beschreibung des politisch-staatlichen <strong>und</strong> <strong>ökonomische</strong>n<br />
Kontextes zu.<br />
Dieses drei Phasen Modell wurde von Lees / Slater / Wyly in <strong>der</strong> zweiten Hälfte <strong>der</strong> '00er<br />
Jahre überarbeitet, um eine vierte Welle <strong>der</strong> Gentrifizierung erweitert <strong>und</strong> aktualisiert (Lees<br />
/ Slater / Wyly 2008, 173-187). Da Lees et al einen wachsenden Einfluss <strong>der</strong> Finanzindustrie<br />
auf Gentrifizierungsprozesse seit <strong>der</strong> dot.com-Krise 2000/01 sehen, haben sie ihrem<br />
Phasenmodell sinnvoller Weise eine Kurve des US-amerikanischen Wirtschaftswachstums<br />
<strong>und</strong> eine Kurve <strong>der</strong> Hypothekenverschuldung <strong>der</strong> privaten Haushalte <strong>der</strong> USA, ausgedrückt<br />
als Prozentsatz am Bruttosozialprodukt, unterlegt. Bevor aber auf diese neuere<br />
Entwicklung im Zusammenhang mit <strong>der</strong> vierten Welle <strong>der</strong> Gentrifizierung eingegangen<br />
wird, sollen zunächst alle vier Phasen vorgestellt werden.<br />
1. WELLE DER GENTRIFIZIERUNG:<br />
Die erste Welle <strong>der</strong> Gentrifizierung fand von den 1950er Jahren bis zur Krise 1973 statt.<br />
Sie wird als räumlich sporadische <strong>und</strong> staatlich angeleitete Gentrifizierungswelle beschrieben.<br />
In diesem Zeitraum reichten privatwirtschaftliche Anreize für eine Initiierung von<br />
Gentrifizierungsprozessen in <strong>der</strong> Regel nicht aus, so dass staatliche Subventionen für kernstädtische<br />
Revitalisierungsprojekte notwendig waren. Legitimiert wurden diese als staatliche<br />
Interventionsmöglichkeit gegen den Verfall <strong>der</strong> Kernstädte, obwohl sie fast ausschließlich<br />
Angehörigen <strong>der</strong> Mittel <strong>und</strong> Oberschicht zu gute kamen. Diese erste Welle entsprach<br />
weitgehend dem was im 1. Kapitel als klassische Gentrifizierung bezeichnet wurde.<br />
Die Rezession Mitte <strong>der</strong> 1970er Jahre verweist jedoch auf umfassende sozio<strong>ökonomische</strong><br />
Restrukturierungen während dieser ersten Welle: <strong>der</strong> Aufstieg Westdeutschlands <strong>und</strong> Japans<br />
als neue <strong>ökonomische</strong> Konkurrenten <strong>der</strong> USA, die Nutzung von Niedriglohnstaaten<br />
als Produktionsstandort u.ä. sind Indizien für eine sich anbahnende Überakkumulationskrise,<br />
die allerdings zunächst kaum Auswirkungen auf Gentrifzierungsprozesse hatte.<br />
2. WELLE DER GENTRIFIZIERUNG<br />
Die zweite Welle <strong>der</strong> Gentrifizierung schloss sich an die Rezession Mitte <strong>der</strong> 1970er Jahre<br />
an <strong>und</strong> dauerte bis zur Rezession Anfang <strong>der</strong> 1990er Jahre. Sie wird beschrieben als eine<br />
Phase, in <strong>der</strong> Gentrifizierungsprozesse zunehmend in <strong>der</strong> Stadtpolitik verankert wurden.<br />
Smith <strong>und</strong> Hackworth schreiben, dass auch Städte, die vorher keine Gentrifizierungsprozesse<br />
aufwiesen, nun bewusst versuchten Kapital für die Gentrifizierung von Stadtquartieren<br />
anzulocken. Resultat war eine quantitative Ausbreitung von Gentrifizierung, die es vorher<br />
noch nicht gegeben hatte (Smith / Hackwort 2001, 466).<br />
Gentrifizierung wurde aber auch in weitere <strong>ökonomische</strong> <strong>und</strong> kulturelle Prozesse auf nationaler<br />
o<strong>der</strong> globaler Ebene integriert. So drückte sich die neoliberale Wende in <strong>der</strong> nationalen<br />
Politik (Deng Xiaoping 1978 in China, Reagan <strong>und</strong> Thatcher 1980 in den USA <strong>und</strong><br />
GB, Kohl 1982 in Westdeutschland) auch in <strong>der</strong> Stadtpolitik aus. Die unternehmerische<br />
Stadtpolitik setzte weniger auf die Versorgung <strong>der</strong> Bevölkerung mit öffentlicher Infrastruktur<br />
<strong>und</strong> mehr auf die <strong>ökonomische</strong> Revitalisierung <strong>der</strong> Städte durch privatkapitalistische<br />
Investitionsprojekte. Nicht nur in den USA <strong>und</strong> Großbritannien herrschte in <strong>der</strong> Stadtentwicklung<br />
eine laissez-faire Haltung vor. Public-Privat-Partnerships wurden relevant <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> Einfluss von Developern, sowie <strong>der</strong> sich globalisierenden Finanz- <strong>und</strong> Immobilienindustrie<br />
auf Gentrifizierungsprozesse wuchs rasant an. New York <strong>und</strong> London stiegen<br />
gleichzeitig zu Global Citys (Sassen 2001) auf. Damit verän<strong>der</strong>ten sich aber auch die Gentrifizierer<br />
<strong>der</strong> zweiten Welle, die sich nun stärker aus den unterschiedlichen Hierarchieebenen<br />
des Managements von (Finanz-) Firmen <strong>und</strong> staatlichen Institutionen rekrutierten <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> Flächenbedarf dieses neuen quartären Sektors machte sich in den Städten bemerkbar<br />
45



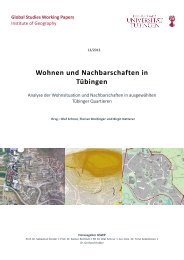




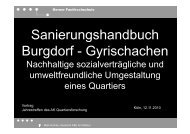


![Wohnen als soziale Kulturtechnik [â¦] (Stephanie Weiss)](https://img.yumpu.com/25621405/1/190x135/wohnen-als-soziale-kulturtechnik-a-stephanie-weiss.jpg?quality=85)