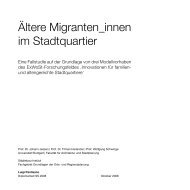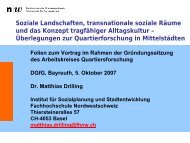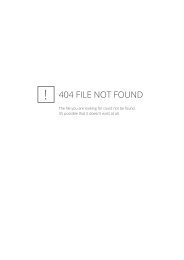Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Profitrate ist bei Marx bestimmt als das Verhältnis von eingesetztem Kapital zum erwirtschafteten<br />
Profit. Aller Profit speist sich aber in letzter Instanz aus dem im Produktionsprozess<br />
auf Basis <strong>der</strong> Ausbeutung <strong>der</strong> Ware Arbeitskraft geschaffenen Mehrwert. Marx<br />
diskutiert daher in extenso Formen, wie dieser Mehrwert zwischen unterschiedlichen Kapitalfraktionen<br />
aufgeteilt werden kann, etwa zwischen Industriekapital, das sich für die Ausweitung<br />
<strong>der</strong> Produktion von einem Finanzkapital einen Kredit besorgt <strong>und</strong> dafür einen Teil<br />
des Mehrwertes als Zins an dieses Finanzkapital abtreten muss. Wie im 3. Kapitel dargelegt,<br />
resultiert <strong>der</strong> größere Teil <strong>der</strong> Profite im Immobiliensektor aus Gr<strong>und</strong>renten. Die Erwirtschaftung<br />
von Gr<strong>und</strong>rente ist aber selbst nicht mehrwertschöpfend. Gr<strong>und</strong>rente wird<br />
also einerseits aus dem im Produktionsprozess hervorgebrachten <strong>und</strong> vom Kapital angeeigneten<br />
Mehrwert, an<strong>der</strong>erseits aus <strong>der</strong> Lohnsumme des Proletariats abgeschöpft. Es ergibt<br />
sich ein eindeutiges Verhältnis: je mehr Gr<strong>und</strong>rente abgeschöpft wird, desto weniger Mehrwert<br />
kann als Profit an an<strong>der</strong>e Kapitalfraktionen verteilt <strong>und</strong> neu investiert werden <strong>und</strong> desto<br />
weniger Geld hat das Proletariat für an<strong>der</strong>e Konsumausgaben zur Verfügung. Die Abschöpfung<br />
von Gr<strong>und</strong>rente kann also einen parasitären Charakter bekommen, in dem Sinne,<br />
dass sie den gesamtgesellschaftlichen Fonds, <strong>der</strong> in die Ausweitung <strong>der</strong> Kapitalakkumulation<br />
investiert werden kann, schmälert.<br />
In diesem Zusammenhang ist es ein interessantes Indiz, dass die Deutschen inzwischen<br />
ein Drittel ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für Miete ausgeben (Süddeutsche Zeitung<br />
2010). Mitte <strong>der</strong> '00er Jahre stieß <strong>der</strong> Autor noch auf eine Website, die eine Konferenz<br />
zum Stadtumbau Ost dokumentierte, auf <strong>der</strong> sich die anwesenden Vertreter von Politik <strong>und</strong><br />
Immobilienwirtschaft über das Problem den Kopf zerbrachen, dass die deutschen Haushalte<br />
nur zwischen einem Sechstel <strong>und</strong> einem Fünftel ihres Haushaltseinkommens für Miete<br />
aufbrächten – ein klares „Entwicklungsdefizit“ gegenüber Staaten wie Irland, Großbritannien,<br />
Spanien o<strong>der</strong> Portugal, wo um einen Drittel des Einkommens für Mieten ausgegeben<br />
würde. Dieser „Entwicklungsvorsprung“ drückt sich <strong>der</strong>zeit in einem Absturz <strong>der</strong> <strong>Immobilienmärkte</strong>,<br />
in einer galoppierenden Staatsverschuldung <strong>und</strong> den bereits erfolgten o<strong>der</strong> drohenden<br />
Zurückstufungen des Kreditratings <strong>der</strong> Staatsanleihen dieser Staaten aus. In den<br />
USA hingegen sollen im Zuge <strong>der</strong> Subprime-Hypothekenkrise inzwischen mehrere Millionen<br />
Haushalte ihre Häuser verloren haben (qualitativ dokumentiert in dem neuen Film Michael<br />
Moors, „Capitalism – a love affair“, USA 2009). Diese Menschen wohnen jetzt zu<br />
großen Teilen in ihren Autos, in Zeltstädten o<strong>der</strong> sind obdachlos. Die 4. Welle <strong>der</strong> Gentrifizierung<br />
erscheint im Lichte dieser Entwicklungen nicht unbedingt als beson<strong>der</strong>s nachhaltiges<br />
urbanes Entwicklungsmodell. Lässt sich dieser Schein aber wissenschaftlich untermauern?<br />
Das soll im Folgenden versucht werden, indem zunächst eine kurze Krisengeschichte des<br />
Kapitalismus seit dem 2. Weltkrieg geschrieben wird, um aus dieser die Finanzialisierung<br />
<strong>der</strong> Weltwirtschaft <strong>und</strong> die gegenwärtige Krise zu erklären. Abschließend wird<br />
Gentrifizierung als Moment <strong>der</strong> Akkumulation aus <strong>der</strong> Substanz des Kapitals dargestellt.<br />
5.1 DIE KRISE DES FORDISMUS<br />
Die relativ stabile fordistische Epoche des Kapitalismus zwischen 1945 <strong>und</strong> <strong>der</strong> Mitte <strong>der</strong><br />
1970er Jahre basierte vornehmlich auf drei Bedingungen: 1.) auf <strong>der</strong> ungeheuren Entwertung<br />
<strong>und</strong> Vernichtung von Kapital <strong>und</strong> Arbeit im 2. Weltkrieg, die die Überakkumulationskrise<br />
<strong>der</strong> 1930er Jahre temporär löste (Scheit 2001), 2.) auf hohen technologischen Surplusprofiten<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> beständigen Erhöhung <strong>der</strong> Arbeitsproduktivität <strong>und</strong> 3.) auf <strong>der</strong> Verteilung<br />
eines Teils dieser Surplusprofite an das Proletariat, das sich dadurch einen höheren<br />
Wohlstand leisten konnte, <strong>der</strong> sich zugleich als Nachfrage auf den Märkten positiv bemerkbar<br />
machte <strong>und</strong> das Wirtschaftswachstum befeuerte. Dieser fordistische Wachstumsmodus<br />
des Kapitalismus brachte aber schon in den 1960er Jahren erste Krisendynamiken hervor<br />
49



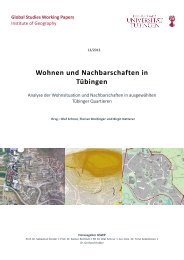




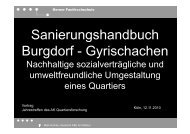


![Wohnen als soziale Kulturtechnik [â¦] (Stephanie Weiss)](https://img.yumpu.com/25621405/1/190x135/wohnen-als-soziale-kulturtechnik-a-stephanie-weiss.jpg?quality=85)