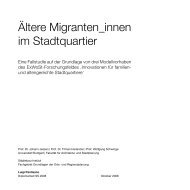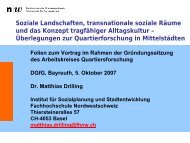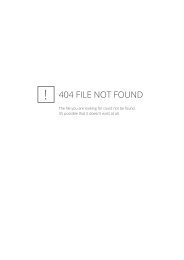Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
märkte ökonomisch zu erklären, weil <strong>der</strong> Akkumulationsprozess des Immobilienkapitals<br />
selbst räumlich disparate Profitabilitätsbedingungen in Städten schafft, die sich zudem in<br />
<strong>der</strong> Zeit verän<strong>der</strong>n. Dieses geografische Moment <strong>der</strong> Kapitalakkumulation liegt damit an<br />
<strong>der</strong> Basis von Gentrifizierungsphänomenen 28 .<br />
4.2 GENTRIFIZIERUNG, KRISEN UND DER „SPATIAL FIX“<br />
Mit Hilfe <strong>der</strong> rent gap-Theorie Smiths lässt sich das übergreifende <strong>ökonomische</strong> Moment<br />
<strong>der</strong> Gentrifizierung aus <strong>der</strong> Logik kapitalistischer urbaner <strong>Immobilienmärkte</strong> erklären. Wie<br />
aber mit dem Hinweis auf eine mögliche „künstliche“ Überhitzung eines städtischen Immobilienmarktes<br />
durch den Zufluss von Finanzkapital bereits angedeutet wurde, werden<br />
lokale urbane <strong>Immobilienmärkte</strong> wie<strong>der</strong>um von den Bewegungen des Kapitals in <strong>der</strong> Gesamtökonomie<br />
beeinflusst. Smith weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Geschehen<br />
auf lokalen <strong>Immobilienmärkte</strong>n <strong>und</strong> damit auch das Gentrifizierungsgeschehen in<br />
einem engen Zusammenhang zu den Boom-Krisen-Zyklen <strong>der</strong> Gesamtökonomie steht (allerdings<br />
häufig kontrazyklisch!). Harvey verweist auf einen engen empirischen Zusammenhang<br />
zwischen Krisen in <strong>der</strong> Gesamtökonomie <strong>und</strong> den räumlichen <strong>und</strong> quantitativen<br />
Verän<strong>der</strong>ungen von Kapitalinvestitionen in die gebaute Umwelt (Harvey 1989a, 1989b,<br />
1999). Es liegt also auf <strong>der</strong> Hand, dass eine <strong>ökonomische</strong> Erklärung von Gentrifizierungsprozessen,<br />
die nur auf <strong>der</strong> skalaren Ebene <strong>der</strong> Region o<strong>der</strong> Stadt operiert, verkürzt wäre.<br />
Gentrifizierung muss auch im Zusammenhang mit dem Geschehen in <strong>der</strong> Gesamtökonomie<br />
erklärt werden. Dieser globale Aspekt lokalen Gentrifizierungsgeschehens wird im Folgenden<br />
untersucht. Dabei wird zunächst das Krisengeschehen im Kapitalismus beleuchtet <strong>und</strong><br />
dann sein systematischer Zusammenhang mit Gentrifizierungsprozessen analysiert.<br />
Ein wesentlicher Teil des wissenschaftlichen Lebenswerkes Harveys widmet sich genau<br />
dem Zusammenhang zwischen Stadtentwicklung <strong>und</strong> gesamtgesellschaftlicher Dynamik<br />
<strong>der</strong> Kapitalakkumulation. Er benutzt dabei drei Begriffe, „Überakkumulationskrise“, „spatio-temporal<br />
fix“ <strong>und</strong> „uneven geographical development“, die hier kurz eingeführt werden<br />
sollen. Harvey geht mit Marx davon aus, dass <strong>der</strong> Akkumulationsprozess des Kapitals beständig<br />
aus sich selbst heraus Dynamiken hervor bringt, die die Kapitalakkumulation in die<br />
Krise treiben. Diese in <strong>der</strong> Kapitalakkumulation selbst angelegten Krisen sind vorrangig<br />
Überakkumulationskrisen. Der Begriff <strong>der</strong> Überakkumulationskrise beschreibt das Phänomen,<br />
dass <strong>der</strong> <strong>der</strong> Kapitalverwertung immanente Wi<strong>der</strong>spruch, dass eine erfolgreiche Kapitalakkumulation<br />
sich durch die Ausbeutung <strong>der</strong> Ware Arbeitskraft tendenziell den eigenen<br />
Absatzmarkt <strong>und</strong> damit die Bedingung <strong>der</strong> Möglichkeit <strong>der</strong> Ausweitung <strong>der</strong> Kapitalakkumulation<br />
untergräbt, auf eine krisenhafte Lösung dieses Wi<strong>der</strong>spruchs drängt.<br />
Die Überlegung ist also, dass <strong>der</strong> Ausbeutungsprozess <strong>der</strong> Ware Arbeitskraft, <strong>der</strong> ja zugleich<br />
<strong>der</strong> Akkumulationsprozess des Kapitals ist, dazu führt, dass sich <strong>der</strong> gesellschaftliche<br />
Reichtum auf Seiten des Kapitals konzentriert. Es wächst ein immer größerer<br />
Kapitalberg heran, <strong>der</strong> nach profitablen Investitionsmöglichkeiten sucht. Da die Profitabilität<br />
von Investitionen aber davon abhängt, dass etwa produzierte Waren o<strong>der</strong> gentrifizierte<br />
Quartiere auch wie<strong>der</strong> verkauft, bzw. vermietet werden müssen, ergibt sich ein Problem,<br />
wenn das Proletariat verarmt <strong>und</strong> zwar in dem Maße, wie das Kapital akkumuliert.<br />
Es entsteht eine Disproportionalität zwischen verwertbarem Kapital einerseits <strong>und</strong> einer<br />
ungenügenden, in Geld ausgedrückten Nachfrage des Proletariats an<strong>der</strong>erseits, die dazu<br />
28 Nebenbei lässt sich mit Hilfe von Smiths rent gap-Theorie auch das relativ späte Einsetzen von starken<br />
Suburbanisierungsprozessen in Westdeutschland in den 1960er Jahren erklären (Häußermann / Siebel<br />
2004). Durch den 2. Weltkrieg waren die Innenstädte zerstört <strong>und</strong> wurden in den 1940ern <strong>und</strong> 1950ern zunächst<br />
wie<strong>der</strong> aufgebaut. Daher gab es in den Kernstädten anfangs ausreichend attraktive Investitionsmöglichkeiten.<br />
Erst nach dem Wie<strong>der</strong>aufbau wan<strong>der</strong>ten dann größere Teile des Immobilienkapitals in die<br />
entstehenden suburbanen Zonen ab.<br />
41



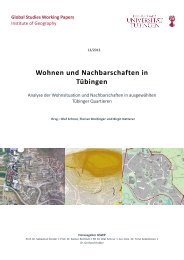




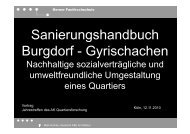


![Wohnen als soziale Kulturtechnik [â¦] (Stephanie Weiss)](https://img.yumpu.com/25621405/1/190x135/wohnen-als-soziale-kulturtechnik-a-stephanie-weiss.jpg?quality=85)