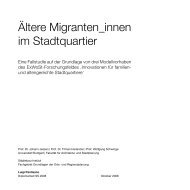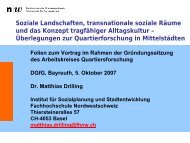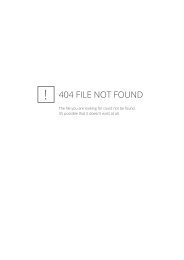Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Urbane Immobilienmärkte und ökonomische Theorien der ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
tivitätssteigerung <strong>der</strong> von ihnen kommandierten Arbeit technologische o<strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Effizienzsteigerung<br />
<strong>der</strong> Arbeitsorganisation resultierende Surplusprofite zu akkumulieren. Die<br />
Konkurrenz muss ihnen bei diesen Produktivitätsfortschritten mindestens folgen, will sie<br />
nicht untergehen (Harvey 1999, 98ff).<br />
Gleichzeitig ergibt sich daraus aber auch das Problem des tendenziellen Falls <strong>der</strong> Profitrate<br />
(Marx 1970, 221-277). Das Gesetz vom tendenziellen Fall <strong>der</strong> Profitrate besagt, dass mit<br />
dem Konkurrenzkampf um technologischen Surplusprofite die organische Zusammensetzung<br />
des Kapitals anwächst, d.h. es muss mehr konstantes Kapital, vorrangig Maschinerie,<br />
im Verhältnis zum variablen Kapital, den Arbeitskräften, angewandt werden, um auf dem<br />
Produktivitätsniveau <strong>der</strong> Gesellschaft konkurrenzfähig produzieren zu können. Da aber nur<br />
Arbeitskraft mehrwertbildend ist, beschneidet die wachsende organische Zusammensetzung<br />
des Kapitals jenen Kapitalanteil, <strong>der</strong> einen Mehrwert produzieren kann, im Verhältnis<br />
zu jenem Kapitalanteil, <strong>der</strong> seinen Wert nur an die Endprodukte weiter gibt, aber selbst keinen<br />
Mehrwert schafft. Es muss also immer mehr <strong>und</strong> teurere Maschinerie im Verhältnis zur<br />
ausbeutbaren Ware Arbeitskraft angewandt werden, was tendenziell die Kapitalprofitablität<br />
reduziert <strong>und</strong> zu einem Fall <strong>der</strong> Profitraten führt, dem durch unterschiedliche Strategien<br />
begegnet werden muss.<br />
Aber zurück zum Wertparadoxon. Dieses versucht Marx durch eine Unterscheidung von<br />
Wert <strong>und</strong> Preis von Waren zu lösen. Während Wert die in kapitalistischen Gesellschaften<br />
den Dingen aus einem sozialen Verhältnis heraus zukommende Substanz, das kapitalistisch-gesellschaftliche<br />
Wesen <strong>der</strong> Waren ist, ist <strong>der</strong> Preis seine auf dem Markt sich offenbarende<br />
Erscheinungsform, <strong>der</strong> sinnlich-konkrete Ausdruck dieser Substanz. Wert ist vom logischen<br />
Status her also eine Kategorie, um die hinter den konkreten, sinnlichen Erscheinungen<br />
liegenden gesellschaftlichen Verhältnisse <strong>und</strong> Prozesse zu begreifen, während <strong>der</strong><br />
Preis die sinnlich erfahrbare Erscheinungsform des Wertes ist, etwa im Preisschild im<br />
Supermarkt.<br />
Zum Verhältnis von Wert <strong>und</strong> Preis sagt Marx, dass <strong>der</strong> Preis vom Wert zwar zeitweise<br />
abweichen könne, aber um ihn oszilliere, da die Konkurrenz auf den Warenmärkten es auf<br />
Dauer nicht erlaube, dass Waren völlig unabhängig von ihrem Wert eingepreist werden<br />
(eine Ausnahme von dieser Regel wären allerdings Monopole). Wert <strong>und</strong> Preis werden<br />
also, vermittelt über die Konkurrenz auf dem Markt, einmal unmittelbar als Preisvergleich,<br />
einmal vermittelt über die durchschnittlich gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Produktion<br />
einer Ware, gesellschaftlich vermittelt <strong>und</strong> bestimmt. Sie resultieren damit nicht<br />
wie in <strong>der</strong> subjektiven Werttheorie aus den subjektiven Wertschätzungen <strong>der</strong> Käufer o<strong>der</strong><br />
aus dem in Geld ausgedrückten Nutzen für diese. Vielmehr ist die in <strong>der</strong> Produktion <strong>der</strong><br />
Waren verausgabte menschliche Arbeitskraft im Verhältnis zur Durchschnittsproduktivität<br />
<strong>der</strong> Arbeit ein objektives Maß für ihren Wert, das sek<strong>und</strong>är auch ihren Preis bestimmt.<br />
Dieser Wert <strong>der</strong> Waren lässt sich aber immer erst im zeitlichen Nachhinein des Produktionsprozesses<br />
auf dem Markt ermitteln, durch seine Realisierung, wie es bei Marx heißt,<br />
also durch den erfolgreichen Verkauf. Kann die Ware nicht verkauft werden, wird ihr Wert<br />
nicht realisiert <strong>und</strong> sie ist wertlos, <strong>der</strong> für den Produktionsprozess vorgeschossene Wert ist<br />
verloren. Der Wert ist damit eine nur dem Kapitalismus eigene gesellschaftliche Eigenschaft<br />
von Dingen o<strong>der</strong> Gebrauchswerten, keine Natureigenschaft. Die auf dem Utilitarismus<br />
aufbauende subjektive Werttheorie hingegen unterscheidet nicht zwischen Gebrauchswert<br />
<strong>und</strong> Tauschwert, bzw. Wert <strong>und</strong> vermischt daher beides.<br />
3.2 EINE ALLGEMEINE THEORIE DER GRUNDRENTE<br />
Wenn <strong>der</strong> Wert einer Ware durch die zu ihrer Produktion verausgabte menschliche Arbeitskraft<br />
bestimmt wird, dann dürften Dinge, die nicht von Menschenhand produziert<br />
worden sind, keinen Wert haben. Ersteres ist beim Boden in seiner elementaren Form <strong>der</strong><br />
21



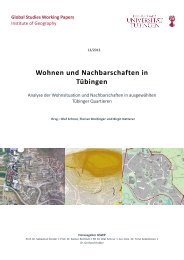




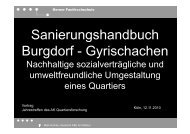


![Wohnen als soziale Kulturtechnik [â¦] (Stephanie Weiss)](https://img.yumpu.com/25621405/1/190x135/wohnen-als-soziale-kulturtechnik-a-stephanie-weiss.jpg?quality=85)