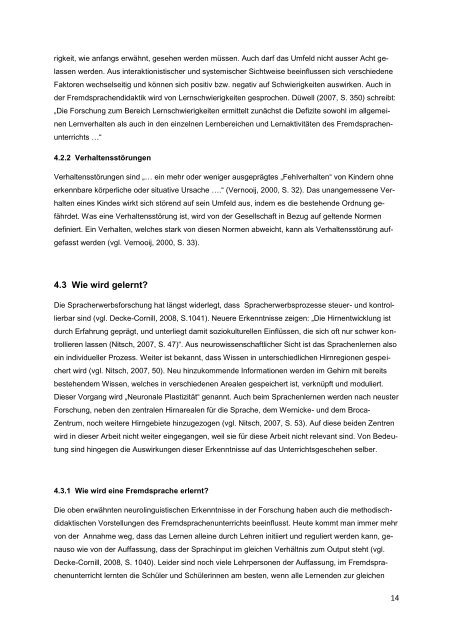Masterarbeit Integration im Frühenglischunterricht - BSCW
Masterarbeit Integration im Frühenglischunterricht - BSCW
Masterarbeit Integration im Frühenglischunterricht - BSCW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
igkeit, wie anfangs erwähnt, gesehen werden müssen. Auch darf das Umfeld nicht ausser Acht ge-<br />
lassen werden. Aus interaktionistischer und systemischer Sichtweise beeinflussen sich verschiedene<br />
Faktoren wechselseitig und können sich positiv bzw. negativ auf Schwierigkeiten auswirken. Auch in<br />
der Fremdsprachendidaktik wird von Lernschwierigkeiten gesprochen. Düwell (2007, S. 350) schreibt:<br />
„Die Forschung zum Bereich Lernschwierigkeiten ermittelt zunächst die Defizite sowohl <strong>im</strong> allgemei-<br />
nen Lernverhalten als auch in den einzelnen Lernbereichen und Lernaktivitäten des Fremdsprachen-<br />
unterrichts …“<br />
4.2.2 Verhaltensstörungen<br />
Verhaltensstörungen sind „… ein mehr oder weniger ausgeprägtes „Fehlverhalten“ von Kindern ohne<br />
erkennbare körperliche oder situative Ursache ….“ (Vernooij, 2000, S. 32). Das unangemessene Ver-<br />
halten eines Kindes wirkt sich störend auf sein Umfeld aus, indem es die bestehende Ordnung ge-<br />
fährdet. Was eine Verhaltensstörung ist, wird von der Gesellschaft in Bezug auf geltende Normen<br />
definiert. Ein Verhalten, welches stark von diesen Normen abweicht, kann als Verhaltensstörung auf-<br />
gefasst werden (vgl. Vernooij, 2000, S. 33).<br />
4.3 Wie wird gelernt?<br />
Die Spracherwerbsforschung hat längst widerlegt, dass Spracherwerbsprozesse steuer- und kontrol-<br />
lierbar sind (vgl. Decke-Cornill, 2008, S.1041). Neuere Erkenntnisse zeigen: „Die Hirnentwicklung ist<br />
durch Erfahrung geprägt, und unterliegt damit soziokulturellen Einflüssen, die sich oft nur schwer kon-<br />
trollieren lassen (Nitsch, 2007, S. 47)“. Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist das Sprachenlernen also<br />
ein individueller Prozess. Weiter ist bekannt, dass Wissen in unterschiedlichen Hirnregionen gespei-<br />
chert wird (vgl. Nitsch, 2007, 50). Neu hinzukommende Informationen werden <strong>im</strong> Gehirn mit bereits<br />
bestehendem Wissen, welches in verschiedenen Arealen gespeichert ist, verknüpft und moduliert.<br />
Dieser Vorgang wird „Neuronale Plastizität“ genannt. Auch be<strong>im</strong> Sprachenlernen werden nach neuster<br />
Forschung, neben den zentralen Hirnarealen für die Sprache, dem Wernicke- und dem Broca-<br />
Zentrum, noch weitere Hirngebiete hinzugezogen (vgl. Nitsch, 2007, S. 53). Auf diese beiden Zentren<br />
wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen, weil sie für diese Arbeit nicht relevant sind. Von Bedeu-<br />
tung sind hingegen die Auswirkungen dieser Erkenntnisse auf das Unterrichtsgeschehen selber.<br />
4.3.1 Wie wird eine Fremdsprache erlernt?<br />
Die oben erwähnten neurolinguistischen Erkenntnisse in der Forschung haben auch die methodisch-<br />
didaktischen Vorstellungen des Fremdsprachenunterrichts beeinflusst. Heute kommt man <strong>im</strong>mer mehr<br />
von der Annahme weg, dass das Lernen alleine durch Lehren initiiert und reguliert werden kann, ge-<br />
nauso wie von der Auffassung, dass der Sprachinput <strong>im</strong> gleichen Verhältnis zum Output steht (vgl.<br />
Decke-Cornill, 2008, S. 1040). Leider sind noch viele Lehrpersonen der Auffassung, <strong>im</strong> Fremdspra-<br />
chenunterricht lernten die Schüler und Schülerinnen am besten, wenn alle Lernenden zur gleichen<br />
14