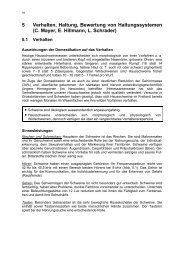Aus dem Institut für Ökologischen Landbau Trenthorst - vTI
Aus dem Institut für Ökologischen Landbau Trenthorst - vTI
Aus dem Institut für Ökologischen Landbau Trenthorst - vTI
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
56<br />
PAUL TEUFEL, Übergreifende Aspekte der Milchhygiene<br />
entsprechender online-Verfahren zur Feststellung<br />
des Keimgehaltes und die qualitätsbezogene Bezahlung<br />
der Milch durch die Molkereien führten sehr<br />
schnell und in Abhängigkeit festgelegter Grenzwerte<br />
zu einem Absinken der Keimzahlen in der Rohmilch.<br />
Die Tab. 1 veranschaulicht die wichtigsten<br />
großen Erfolge der Milchhygiene in den<br />
vergangenen 30 Jahren. Sie betreffen auch die<br />
Hemmstoffe, die Mykotoxine und die Dioxine.<br />
Grundprinzipien<br />
Für die eigenverantwortliche Qualitätssicherung<br />
im Milcherzeugerbetrieb ergaben sich aus diesen<br />
Arbeiten zwei grundlegende Ansätze. Zum einen ist<br />
es ein parameterbezogenes Vorgehen, bei <strong>dem</strong><br />
Zielwerte zu Keimzahl, Zellzahl, Rückstände und<br />
Kontaminanten die entsprechenden Maßnahmen zur<br />
Verringerung oder Vermeidung des jeweiligen<br />
Parameters bedingen. Zum anderen werden die<br />
Rahmenbedingungen definiert, welche die<br />
Anforderungen an die Milchkühe, an den<br />
Erzeugerbetrieb und das Melken stellen. Ganz im<br />
Sinne moderner Managementsysteme muss auch<br />
die eigenverantwortliche Tätigkeit praktikabel und<br />
umsetzbar sein. Als Beispiel <strong>für</strong> diese Ansätze soll<br />
hier der somatische Zellgehalt der Milch dargestellt<br />
werden. Der Zellgehalt ist der Leitparameter <strong>für</strong> die<br />
Mastitisbekämpfung und <strong>für</strong> die Produktqualität im<br />
Hinblick auf die Zusammensetzung der Milch.<br />
Aspekte des Verbraucherschutzes werden ebenfalls<br />
berücksichtigt. Die gesetzliche Mindestanforderung<br />
ist derzeit bei 400.000 Zellen pro ml festgelegt, in<br />
der Praxis liegen die Werte bereits unter 200.000<br />
und die 100.000 Zellen pro ml (Mittelwert der<br />
physiologischen „Normalität“) erscheinen<br />
erreichbar. Maßgeblich wird der Zellgehalt durch<br />
die Eutergesundheit beeinflusst, die ihrerseits von<br />
Fütterung, Haltungssystemen („Kuhkomfort“) und<br />
Melkhygiene abhängt. In der Praxis richtet sich die<br />
Mastitisbekämpfung und -vorbeugung an <strong>dem</strong> 5<br />
Punkte-Plan aus. Dieser 5 Punkte-Plan beinhaltet<br />
das Zitzentauchen, die Trockenstellbehandlungen,<br />
die Laktationsbehandlung, die<br />
Melkmaschinenkorrektur und die <strong>Aus</strong>merzung<br />
behandlungsresistenter Tiere. Darüber hinaus wird<br />
Wert auf die Zitzenpflege gelegt, wobei hier eine<br />
saubere, glatte und weiche Oberfläche der Zitze<br />
angestrebt wird.<br />
Werden an einem derartigen System Änderungen<br />
vorgenommen, z.B. bei veränderten Haltungsformen,<br />
so können sich zum einen Vorteile ergeben;<br />
zum anderen werden sich in neuen Systemen<br />
aber auch Nachteile ergeben. Die ökologische<br />
Milchviehhaltung zielt auf einen reduzierten Antibiotikaeinsatz<br />
bei höherer Tiergerechtigkeit und<br />
nachhaltiger Kontrolle der Produktionsbedingungen.<br />
Gleichzeitig können sich aber Probleme mit<br />
der Eutergesundheit ergeben, welche ihren Ursprung<br />
im unkontrollierten Zukauf aus gleichartigen<br />
Beständen und der Nichterfüllung rasse- und<br />
zuchtbedingter bedarfsabhängiger Fütterung haben.<br />
Schlussfolgerungen<br />
Als Konsequenz ergibt sich, dass der doppelte<br />
Ansatz Parametermodell und Festigung der<br />
Rahmenbedingungen im Grunde genommen<br />
zunächst <strong>für</strong> alle Produktionsformen gilt. Wenn in<br />
einem bewährten System grundlegende<br />
Änderungen vorgenommen werden, ist an anderer<br />
Stelle zur Aufrechterhaltung der milchhygienischen<br />
Forderungen ein <strong>Aus</strong>gleich zu schaffen. Die bisher<br />
erarbeiteten Parameter und Zielvorstellungen zur<br />
„normalen Milch“ reichen <strong>für</strong> die objektive<br />
Bewertung der Eutergesundheit und der Rohmilch<br />
unter den Gesichtspunkten des gesundheitlichen<br />
Verbraucherschutzes und der<br />
Verarbeitungsfähigkeit der Milch aus.<br />
<strong>Aus</strong>blick<br />
In Zusammenarbeit mit der FAL wurde gerade<br />
ein gemeinsames Projekt begonnen, das sich speziell<br />
der Schaf- und Ziegenmilch widmet. Hier liegt<br />
eine <strong>Aus</strong>gangssituation vor, die der von 1970 bei<br />
der Kuhmilch etwa entsprechen würde. Deswegen<br />
sollen in diesem Projekt zum einen die Methoden,<br />
die <strong>für</strong> die Kuhmilch zu so großem Erfolg geführt<br />
haben validiert, bzw. auf die Milch der kleinen<br />
Wiederkäuer angepasst werden. Zum anderen soll<br />
der Einsatz bekannter Parameter dazu dienen,<br />
Normvorstellungen zur Beurteilung der Eutergesundheit<br />
und der Milchqualität (Zellen und Keime)<br />
zu erarbeiten. Hierbei steht nicht der Vergleich mit<br />
konventioneller Schaf- und Ziegenhaltung an, sondern<br />
die Erarbeitung der entsprechenden Parameter<br />
unter den Gegebenheiten der ökologischen Tierhaltung.