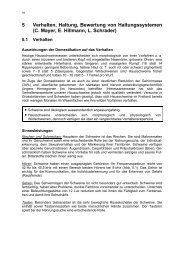Aus dem Institut für Ökologischen Landbau Trenthorst - vTI
Aus dem Institut für Ökologischen Landbau Trenthorst - vTI
Aus dem Institut für Ökologischen Landbau Trenthorst - vTI
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
niemand ernsthaft auf den Gedanken als Beitrag zur<br />
Reduzierung der nationalen Ammoniakemissionen<br />
die Rückkehr zur Anbindehaltung zu fordern.<br />
(2) Die Notwendigkeit der Legehennenhaltung<br />
in Käfigen wurde über längere Zeit damit<br />
begründet, dass die Umweltbelastungen<br />
(Ammoniak, Stäube, Keime) bei alternativen<br />
Haltungsverfahren um ein Vielfaches höher sind.<br />
Trotz eingestandener, ungelöster Zielkonflikte gibt<br />
es die Gesetzgebung zum <strong>Aus</strong>stieg aus der<br />
Käfighaltung.<br />
Das Beispiel aus der Rinderhaltung betrifft die<br />
konventionelle genauso wie die ökologische<br />
Produktionsweise, wobei die größere<br />
Bewegungsfläche <strong>für</strong> Tiere in Öko-Betrieben<br />
tendenziell höhere Emissionen erwarten lässt.<br />
Selbst aus aufwändig durchgeführten<br />
Praxismessungen (Müller et al. 2001) können zu<br />
diesem Problem noch keine <strong>Aus</strong>sagen getroffen<br />
werden. Die Käfighaltung von Legehennen, als<br />
zweites Beispiel <strong>für</strong> divergente Forderungen der<br />
Gesellschaft, ist zwar kein Thema <strong>für</strong> ökologisch<br />
wirtschaftende Betriebe, ist aber gewählt worden,<br />
um einen in der Öffentlichkeit sehr bekannten Fall<br />
darzustellen. In diesem Fall ist die öffentliche<br />
Darstellung und damit auch die Wahrnehmung in<br />
der Gesellschaft sehr stark auf das Wohlbefinden<br />
der Tiere ausgerichtet worden. Auf <strong>dem</strong><br />
Kenntnisstand des Jahres 2000 basierend,<br />
verursacht eine Henne in Volierenhaltung mit<br />
Kotbandtrocknung (Abb. 2) nahezu die 2,5fache<br />
Ammoniakemission gegenüber einer im Käfig (mit<br />
Kotband und -trocknung) gehaltenen (Dohler et al..<br />
2002). Neuere Entwicklungen deuten jedoch darauf<br />
hin, dass Volierenhaltung deutlich niedrigere Werte<br />
erreichen können (van Emous und Fiks-van<br />
Nienkerk 2002).<br />
Abbildung 2<br />
Legehennen in einem Volierenstall<br />
Die Richtlinien zur Tierhaltung im ökologischen<br />
<strong>Landbau</strong> (z. B. EU-Verordnung (EG) 1804/1999)<br />
sind bisher sehr stark durch ethische Betrachtungen<br />
geprägt. Dies wird vor allem in der Dominanz von<br />
Anforderungen zum Tierschutz sichtbar. Mit der<br />
weiteren <strong>Aus</strong>dehnung der ökologischen Tierhaltung<br />
REINER BRUNSCH, Verfahrenstechnische Beiträge zur Integration von Tier- und Umweltschutzzielen 71<br />
wird auch eine komplexe Prüfung der Umweltwirkungen<br />
der speziellen Produktionsverfahren durchzuführen<br />
sein.<br />
Gerade auf diesem Gebiet besitzt unser <strong>Institut</strong><br />
erhebliche personelle und methodische Kompetenz.<br />
In interdisziplinären Forschergruppen wird an der<br />
Schnittstelle zwischen biologischen und<br />
technischen Systemen gearbeitet. Eine wesentliche<br />
Aufgabe der Verfahrensforschung in der<br />
Nutztierhaltung besteht in der Analyse von<br />
physikalischen, chemischen und biologischen<br />
Wirkmechanismen. Die Resultate solcher<br />
Untersuchungen fließen in einen Prozess der<br />
Synthese, in dessen Ergebnis neue Verfahren<br />
entstehen bzw. bestehende Verfahren anhand der<br />
vielfältigen Anforderungen der Gesellschaft<br />
bewertet werden können. Auf diese Weise lässt sich<br />
der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung auf<br />
Tierhaltungsverfahren anwenden.<br />
Mit wiederum je einem Beispiel aus der<br />
Rinderhaltung und der Geflügelproduktion soll<br />
Einblick in aktuelle Forschungsarbeiten am ATB<br />
gewährt werden, deren bisherigen Ergebnisse<br />
Anlass zum Optimismus geben, viele Zielkonflikte<br />
auflösen zu können. Dies kann jedoch in der Regel<br />
weder in der von der Politik geforderten kurzen<br />
Zeit, noch ohne Bereitschaft seitens der Vertreter<br />
des Tierschutzes über statische Festlegungen<br />
wissenschaftlich zu streiten, erfolgen.<br />
Umweltwirkung ganzjähriger Außenhaltung von<br />
Mutterkühen<br />
Diese vitalitätsfördernde Haltung erfreut sich<br />
auch infolge von günstigen Verfahrenskosten<br />
wachsender Beliebtheit, insbesondere zur<br />
extensiven Grünlandbewirtschaftung. Das<br />
Verfahren wird auch in zahlreichen ökologisch<br />
wirtschaftenden Betrieben Ostdeutschlands<br />
praktiziert.<br />
Abbildung 3<br />
Freiland-Winterquartier <strong>für</strong> Mutterkühe mit 15 bis 20 kg<br />
Stroh je Großvieheinheit und Tag<br />
In der Literatur sind Nährstoffverlagerungen<br />
während der Beweidung beschrieben, es fehlen aber<br />
Untersuchungen zum Risiko der <strong>Aus</strong>waschung von