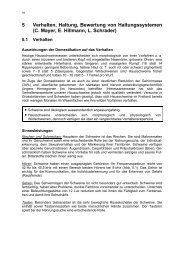Aus dem Institut für Ökologischen Landbau Trenthorst - vTI
Aus dem Institut für Ökologischen Landbau Trenthorst - vTI
Aus dem Institut für Ökologischen Landbau Trenthorst - vTI
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
LOTHAR KRÖCKEL, Nutzbarmachung mikrobiologisch-genetischer Ressourcen zur Biokonservierung von Fleischerzeugnissen 67<br />
Altgeschmack, Geruchsabweichungen, Verfärbungen)<br />
oder sensorisch unauffällig bleiben. Die Haltbarkeit<br />
derartiger Erzeugnisse ist daher auch unter<br />
Kühlung begrenzt. Im Handel sind Mindesthaltbarkeitsdaten<br />
(MHD) von 14 - 28 Tagen üblich. In<br />
Abwesenheit einer Konkurrenzflora kann sich unter<br />
diesen Bedingungen aber auch Listeria monocytogenes<br />
vermehren und gefährlich hohe Keimzahlen<br />
erreichen. Dieses Bakterium kann bei immunschwachen<br />
Risikogruppen (Kleinkinder, Senioren,<br />
Schwangere, abwehrgeschwächten Patienten) tödlich<br />
verlaufende Infektionen auslösen. Theoretisch<br />
gibt es mehrere Möglichkeiten diesem Problem zu<br />
begegnen (Tab. 1).<br />
Da die Rekontamination mit "betriebseigenen"<br />
Milchsäurebakterien ebenso zufällig wie die mit<br />
Listerien erfolgt, ist eine ausreichende Konkurrenzflora<br />
nicht immer garantiert. Es liegt daher nahe,<br />
bei vorverpacktem Kochschinken- und Brühwurstaufschnitt<br />
geeignete Milchsäurebakterien gezielt als<br />
Schutzkulturen einzusetzen und damit die Produktsicherheit<br />
und möglicherweise auch die Produktqualität<br />
zu verbessern (Andersen 1995, 1997).<br />
Nationale und internationale Aktivitäten<br />
Für eine "biologische Konservierung" mittels<br />
geeigneter Schutzkulturen spricht, dass die da<strong>für</strong> in<br />
Frage kommenden Mikroorganismen bereits heute<br />
in großer Zahl in vielen Lebensmitteln vorkommen,<br />
z.B. als Starterkulturen oder als Probiotika, und regelmäßig<br />
in hoher Zahl konsumiert werden (Nieto-<br />
Lozano et al. 2002). Besonders wirksam gegen<br />
Listeria monocytogenes sind solche Milchsäurebakterien,<br />
die anti-listerielle Peptide, sog. Bacteriocine,<br />
ausscheiden (Abb. 1) (Benkerroum et al.<br />
2003, Cleveland et al. 2001, Hugas 1998, Katla et<br />
al. 2002, Kröckel 1998 c, McMullen und Stiles<br />
1996).<br />
Abbildung 1<br />
Verhalten von Listeria monocytogenes auf vakuumverpacktem<br />
Brühwurstaufschnitt in Gegenwart bacteriocinogener<br />
(offene Quadrate) und nicht bacteriocinogener<br />
(volle Kreise) Schutzkulturen (Milchsäurebakterien<br />
der Art Lactobacillus sakei) bei 7°C.<br />
Listerien (log KBE/g)<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0 7 14 21 28<br />
Lagerung (Tage)<br />
Bacteriocin bildende Milchsäurebakterien aus<br />
Fleisch und Fleischerzeugnissen werden an der<br />
BAFF seit Mitte der 80er Jahre intensiv beforscht<br />
(Schillinger und Lücke 1989, Hühne et al. 1996,<br />
Kröckel 1999 a, b). Darüber hinaus befassen sich<br />
sowohl national wie auch international viele <strong>Institut</strong>ionen<br />
mit dieser Fragestellung (Holzapfel et al.<br />
1995, Gänzle et al. 1996, Bredholt et al. 1999, Nilsson<br />
et al. 1999). In Dänemark wurde im vergangenen<br />
Jahr <strong>für</strong> die Anwendung eines bacteriocinogenen<br />
Milchsäurebakteriums, Leuconostoc carnosum,<br />
<strong>für</strong> die Biokonservierung von vorverpacktem<br />
Brühwurstaufschnitt eine befristete Zulassung erteilt<br />
(Jacobsen et al. 2002). Bakterien dieser Art<br />
kommen auf vorverpacktem Kochschinken- und<br />
Brühwurstaufschnitt relativ häufig vor.<br />
Mikrobiologische genetische Ressourcen -<br />
Sammlung und Nutzbarmachung<br />
Die Bundesanstalt <strong>für</strong> Fleischforschung verfügt<br />
über eine umfangreiche Sammlung von Milchsäurebakterien<br />
(MSB) aus Fleisch und Fleischerzeugnissen,<br />
die gegenwärtig mehr als 1000 Isolate umfaßt.<br />
Diese Isolate aus der konventionellen Produktion<br />
sind wichtige genetische Ressourcen <strong>für</strong> die<br />
Selektion von Starter- und Schutzkulturen <strong>für</strong> Fleischerzeugnisse<br />
sowie <strong>für</strong> die Erforschung der indigenen<br />
Flora von Fleisch und Fleischerzeugnissen.<br />
Seit kurzem werden die Isolate phänotypisch und<br />
genotypisch überprüft und in Zusammenarbeit mit<br />
der ZADI in einer neugeschaffenen, frei zugänglichen<br />
Datenbank dokumentiert (http://www.genres.de/mgrdeu).<br />
Weit weniger erforscht ist die Mikroflora von<br />
Fleisch und Fleischerzeugnissen aus der ökologischen<br />
Produktion. Bei der Herstellung von fermentierten<br />
Fleischerzeugnissen werden allerdings häufig<br />
konventionelle Starterkulturen eingesetzt. Ein<br />
Rückgriff auf eigene mikrobiologisch-genetische<br />
Ressourcen erfolgte offenbar auf Grund fehlender<br />
Untersuchungen bislang nicht.<br />
Grundlage einer Nutzbarmachung mikrobiologisch-genetischer<br />
Ressourcen zur Biokonservierung<br />
von Fleischerzeugnissen ist die Charakterisierung<br />
der produkttypischen Mikroflora. Dazu werden<br />
Reinkulturen der dominanten Milchsäurebakterien<br />
isoliert, gesammelt und phänotypisch und genotypisch<br />
untersucht (Kröckel 1998 d). Die Selektion<br />
technologisch nutzbarer Kulturen erfolgt nach definierten<br />
Anforderungsprofilen, insbesondere technologischer<br />
Eignung, gesundheitlicher Unbedenklichkeit,<br />
Durchsetzungsvermögen und Dominanz<br />
im Lebensmittel in Verbindung mit einer effizienten<br />
Unterdrückung der unerwünschten Begleitflora,<br />
insbesondere der pathogenen Mikroorganismen. An<br />
Bedeutung gewinnen in jüngster Zeit auch probiotische<br />
Aspekte (Hammes und Haller 1998). Interessante<br />
Kulturen werden in Challenge-Versuchen auf<br />
ihre Wirksamkeit bei der Kontrolle der unerwünschten<br />
Kontaminationsflora getestet und bewertet.<br />
Gut charakterisierte und in Challenge-<br />
Versuchen getestete Milchsäurebakterien, die als<br />
Schutzkulturen eingesetzt werden könnten, sind die