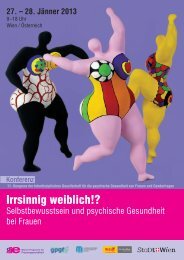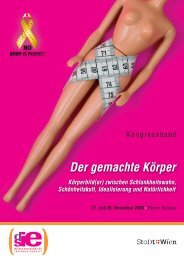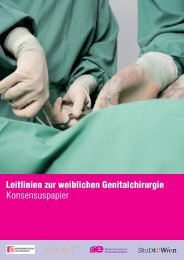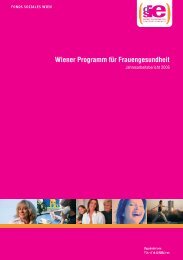Forschung Migration und Gesundheit im Rah - Bundesamt für ...
Forschung Migration und Gesundheit im Rah - Bundesamt für ...
Forschung Migration und Gesundheit im Rah - Bundesamt für ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1 Einleitung<br />
Mit einem Anteil von 21,7% der ausländischen Bevölkerung<br />
an der Wohnbevölkerung <strong>im</strong> Jahr 2003 (Heiniger et al., 2004)<br />
gehört die Schweiz zu den Ländern Europas mit dem relativ<br />
höchsten Ausländeranteil. Die Raten schwanken dabei sehr<br />
stark zwischen max<strong>im</strong>al 37,8% <strong>im</strong> Kanton Genf <strong>und</strong> min<strong>im</strong>al<br />
8,2% <strong>im</strong> Kanton Uri; der Kanton Zürich liegt mit 22,0% nahe<br />
be<strong>im</strong> gesamtschweizerischen Durchschnitt (Statistisches Amt,<br />
2003). Typischerweise leben die in der Schweiz wohnenden<br />
Ausländer schon sehr lange <strong>im</strong> Lande (36% seit mindestens<br />
15 Jahren (Heiniger et al., 2004). Der hohe Ausländeranteil <strong>und</strong><br />
die lange Aufenthaltsdauer werden auch über die sehr niedrigen<br />
Einbürgerungsraten in den schweizerischen Kantonen<br />
(z.B. Zürich 1,8% jährlich <strong>im</strong> Vergleich zu 3,0% <strong>im</strong> EU-Durchschnitt<br />
[ohne, 2000]) vermittelt. In der politischen Bewältigung<br />
der besonderen Lebenssituation von Ausländern wird von einem<br />
schlechteren Ges<strong>und</strong>heitszustand bei der ausländischen<br />
Bevölkerung ausgegangen, der auch eine verbesserte Responsivität<br />
des schweizerischen Ges<strong>und</strong>heitssystems auf die<br />
besonderen Bedürfnisse dieses Bevölkerungsteils erfordert.<br />
Zur psychischen Ges<strong>und</strong>heit von MigrantInnen existieren (in<br />
der Schweiz wie andernorts) bislang nur wenige Untersuchungen<br />
(Weiss, 2003). Dieser Umstand lässt sich wohl zurückführen<br />
auf die grosse Heterogenität, welche <strong>Migration</strong>sprozesse<br />
vor, während <strong>und</strong> nach dem Faktum des Wohnsitzwechsels<br />
annehmen können. Zudem wird generell festgestellt, dass <strong>für</strong><br />
den Erhalt der psychosozialen Ges<strong>und</strong>heit juristische, strukturelle<br />
<strong>und</strong> gesellschaftliche Bedingungen <strong>im</strong> <strong>Migration</strong>sprozess<br />
<strong>und</strong> in den Aufnahmeländern ausschlaggebend sind. Diese<br />
variieren erheblich (Weiss, 2003). Zu den nachweislichen Belastungen<br />
nach der Ankunft <strong>im</strong> Zielland gehörte <strong>für</strong> die ausländische<br />
Bevölkerung <strong>im</strong> Kanton Zürich beispielsweise die in<br />
den späten 90er-Jahren drei- bis fünffach höhere Arbeitslosenquote<br />
in Zeiten der wirtschaftlichen Rezession (Diethelm et<br />
al., 1999). Im Vorfeld manifester psychiatrischer Erkrankungen<br />
existieren <strong>für</strong> die Schweiz in diesem Zusammenhang Daten<br />
aus der Schweizerischen Ges<strong>und</strong>heitsbefragung, inwieweit<br />
sich MigrantInnen <strong>im</strong> psychischen Wohlbefinden von der<br />
schweizerischen Bevölkerung unterscheiden: Demnach fühlten<br />
sich die SchweizerInnen <strong>im</strong> Jahr 2002 psychisch schlecht<br />
ausgeglichen zu 19,5% (Männer: 18,8% Frauen: 20,1%), während<br />
AusländerInnen die entsprechende Frage klar häufiger<br />
mit 25,9% (Männer: 23,7% Frauen: 28,2%) <strong>für</strong> sich bejahten<br />
(Tabelle P36D in: Heiniger et al., 2004). Diese höhere psychische<br />
Belastung von Ausländern in der Schweiz ist allerdings<br />
nicht verb<strong>und</strong>en mit einer einheitlich höheren Inanspruchnahme<br />
von stationär-psychiatrischen Leistungen. Im Vergleich<br />
zum gesamtschweizerischen Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung<br />
von über 20% ist in der Population der stationären<br />
psychiatrischen Behandlungen in der Schweiz nur ein Ausländeranteil<br />
von 16,6% zu beobachten (vgl. Christen & Christen,<br />
2003, <strong>für</strong> die Jahre 1998–2000).<br />
Neben der Gesamtzahl an stationären Behandlungen ist aber<br />
auch die Art der Diagnosen in der Regel abweichend (Weiss,<br />
2003). Für die Schweiz wurden solche veränderten Diagnosenzusammensetzungen<br />
innerhalb der behandelten ausländischen<br />
PatientInnen in stationärer Psychiatrie <strong>für</strong> alle drei<br />
Sprachregionen berichtet: Für das Tessin nennen Testa-Mader<br />
et al., 2003, <strong>für</strong> das Jahr 1995 höhere Hospitalisierungsraten<br />
bei nicht italienischen männlichen Ausländern <strong>für</strong> F2-Diagnosen<br />
(ICD10-Code <strong>für</strong> Schizophrenien) <strong>und</strong> eine höhere Hospitalisierungsrate<br />
bei nicht italienischen Frauen hinsichtlich<br />
substanzgeb<strong>und</strong>ener Abhängigkeitsstörungen (F1-Diagnosen).<br />
Demgegenüber sahen Baleydier <strong>und</strong> Kollegen in Genf<br />
weniger Alkoholstörungen, weniger Persönlichkeitsstörungen<br />
<strong>und</strong> mehr affektive Erkrankungen, als <strong>im</strong> Vergleich zur schweizerischen<br />
Patientenpopulation zu erwarten gewesen wäre<br />
(Baleydier et al., 2003). Für den Kanton Zürich 1995 bis 2001<br />
gelangen Lay <strong>und</strong> Mitarbeiter zu der differenzierteren Aussage,<br />
dass MigrantInnen aus Bosnien <strong>und</strong> aus der Türkei in der<br />
Inanspruchnahmepopulation bei alkoholbezogenen Störungen<br />
unterrepräsentiert, aber südeuropäische <strong>und</strong> osteuropäische<br />
MigrantInnen klar überrepräsentiert sind, während Anpassungs-<br />
<strong>und</strong> Belastungsstörungen (F4-Diagnosen) vor allem<br />
in der Patientengruppe aus Ex-Jugoslawien <strong>und</strong> der Türkei<br />
deutlich überrepräsentiert sind (Lay et al., 2005). Affektive<br />
Erkrankungen (F3-Diagnosen) <strong>und</strong> Persönlichkeitsstörungen<br />
(F6-Diagnosen) unterscheiden sich dagegen in Zürich weniger<br />
deutlich nach regionaler Herkunft (vgl. Tabelle 2 <strong>im</strong> genannten<br />
Artikel). Für die Genfer <strong>und</strong> die Zürcher Studie bleibt festzuhalten,<br />
dass nicht das Hospitalisierungsrisiko populationsbezogen<br />
ausgewertet wurde, sondern lediglich die Inanspruchnahmepopulationen<br />
mit dem Diagnosemix der schweizerischen<br />
PatientInnen verglichen wurden.<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> n<strong>im</strong>mt sich die vorliegende Studie<br />
zum Ziel, die Gesamtzahl aller stationären psychiatrischen<br />
Behandlungen populationsbezogen zwischen SchweizerInnen<br />
<strong>und</strong> AusländerInnen <strong>im</strong> bevölkerungsreichsten Kanton der<br />
Schweiz erstmals über einen längeren Zeitraum hinweg zu<br />
verfolgen. Es soll untersucht werden, ob stationär-psychiatrische<br />
Behandlungen insgesamt bei SchweizerInnen <strong>und</strong> bei in<br />
der Schweiz wohnhaften AusländerInnen unterschiedlich häufig<br />
sind, <strong>und</strong> ob sich nach Geschlecht, Alter, Herkunftsland <strong>und</strong><br />
Sozialstruktur des Wohnortes charakteristische Muster der<br />
stationären Inanspruchnahme beobachten lassen. Dadurch<br />
können <strong>für</strong> die Schweiz erstmals zeitliche Trends <strong>im</strong> Vergleich<br />
dieser Bevölkerungsgruppen nachvollzogen werden.<br />
2 Stichproben <strong>und</strong> Methoden<br />
Stationäre psychiatrische Behandlungen werden <strong>im</strong> Kanton<br />
Zürich seit dem Jahr 1995 von allen regionalen Gr<strong>und</strong>versorgungskliniken,<br />
seit 1998 auch von einigen (kleineren) zunächst<br />
noch nicht beteiligten Spezialversorgern (vor allem <strong>im</strong> Suchtbereich)<br />
der Arbeitsgruppe Public Mental Health an der Psychiatrischen<br />
Universitätsklinik Zürich gemeldet. Die Wohnorte<br />
der stationären PatientInnen werden mit der Postleitzahl registriert,<br />
aus der sich in der überwiegenden Zahl aller Fälle die<br />
Herkunftsgemeinde zuordnen lässt. Für Postleitzahlen innerhalb<br />
der Stadt Zürich wurde eine Gebietsunterteilung anhand<br />
der 12 Stadtkreise vorgenommen.<br />
Populationsbezogene Auswertungen wurden analog zur Nationalitäten-Einteilung<br />
der amtlichen Bevölkerungsstatistik<br />
lediglich nach Schweizer/Nichtschweizer unterschieden, Auswertungen<br />
der Patientendaten dagegen mit einer genaueren<br />
Unterscheidung der Herkunftsländer. Das Aufnahmealter der<br />
71