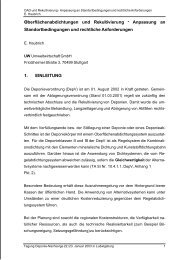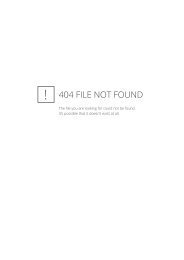verfügbar hier
verfügbar hier
verfügbar hier
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Deponierückbau – Erhebung der Abfallmengen und -Arten in Österreich<br />
3 ERHEBUNG DER ABFALLMENGEN UND -ARTEN<br />
IN ÖSTERREICH<br />
3.1 Entwicklung der Ablagerung von Abfällen in Österreich<br />
In den Nachkriegsjahren bis 1970 kam es in Österreich zu einem starken Wirtschaftswachstum<br />
und damit verbunden auch zu einer Steigerung des Lebensstandards<br />
für die Bevölkerung. Die umgesetzten Gütermengen sind dabei enorm<br />
gestiegen, was auch zu einem entsprechenden Wachstum im Abfallaufkommen<br />
führte. Wegen fehlender Vorschriften und Gesetze ging die Entsorgung der Abfälle<br />
bis in die 70er-Jahre im Wesentlichen durch unorganisierte Ablagerung vor<br />
sich. Dabei verfügte jede Gemeinde über mehrere Plätze zum Abladen von Abfällen<br />
in der Landschaft, oft handelte es sich dabei um Gruben in Waldgebieten<br />
(OSSBERGER 1997).<br />
Diese kleinen Gemeindedeponien sind aufgrund ihrer geringen Größe und dem<br />
damit verbundenen geringen Ressourcenpotenzial nicht für den Rückbau zur<br />
Gewinnung von Wertstoffen geeignet.<br />
Im Laufe der 70er-Jahre entwickelte sich die Abfallgesetzgebung der Bundesländer<br />
und es kam zur Errichtung von Abfallbeseitigungsverbänden. Die „wilden”<br />
Deponien bestanden aber trotz langsam anlaufender Gesetzgebung und<br />
einer Vielzahl an Verboten zum Teil weiter und wurden auch ohne behördliche<br />
Genehmigungsverfahren weiterhin in Betrieb genommen. Mit der immer größer<br />
werdenden Zahl an Abfallverbänden wurden aber auch immer mehr kleine Gemeindedeponien<br />
durch große Verbandsdeponien ersetzt (OSSBERGER 1997).<br />
Diese stellen aufgrund ihrer Größe und dem zu erwartenden Ressourcenpotenzial<br />
mögliche Objekte für den Deponierückbau dar.<br />
Die Richtlinie für die Ablagerung von Abfällen, die 1990 vom Bundesministerium<br />
für Umwelt, Jugend und Familie gemeinsam mit dem Bundesministerium für<br />
Land- und Forstwirtschaft erstellt wurde, enthält eine erste Definition von Deponietypen<br />
mit Beispielen für zur Ablagerung geeignete Abfallarten:<br />
Interstoffdeponie: sortierter Bauschutt (ohne Baustellenabfälle), Steinschleifschlamm,<br />
Strahlmittelrückstände, Gipsabfälle, jeweils ohne schädliche Beimengungen;<br />
Reststoffdeponie: Kohlenasche, Flugaschen und -stäube aus der thermischen<br />
Abfallbehandlung (nach Schadstoffimmobilisierung), Gießerei-Altsande<br />
ohne organische Bindemittel, bestimmte Galvanikschlämme nach Behandlung;<br />
Kompartimentdeponie: Müllverbrennungsschlacke, Carbidschlamm, mineralölverunreinigtes<br />
Erdreich, aluminiumhaltige Abfälle;<br />
Reaktordeponie: Müll, Textilabfälle, stabilisierte und entwässerte Schlämme<br />
aus der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung;<br />
Untertagedeponie: cyanidhaltige Härtesalze, radioaktive Abfälle.<br />
Von den genannten Deponietypen kommen in erster Linie Reaktordeponien und<br />
Reststoffdeponien für den Rückbau in Frage. Reine Kompartimentdeponien, auf<br />
denen andere Abfälle als Baurestmassen oder Bodenaushub abgelagert wurden,<br />
sind selten. Eine Untertagedeponie wurde in Österreich bis dato nicht verwirklicht.<br />
32 Umweltbundesamt Wien 2011