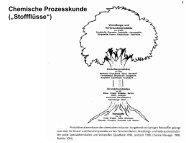Text anzeigen (PDF) - bei DuEPublico
Text anzeigen (PDF) - bei DuEPublico
Text anzeigen (PDF) - bei DuEPublico
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
42 KAPITEL 3. EXPERIMENTELLE METHODEN<br />
hohe Transmission im nahen UV auszeichnen. Als Referenz dient das gleiche Lösemittel<br />
ohne Azopolymer. Bei der Untersuchung von dünnen Azofilmen wird ein Glasobjektträger<br />
verwendet (vgl. Kap. 4).<br />
3.1.2 Untersuchung dünner Schichten mit Methoden der<br />
Prismenkopplung<br />
Für die Charakterisierung dünner Azoschichten werden zwei in der Integrierten Optik gän-<br />
gige Methoden verwendet. Beide basieren auf dem Prinzip der Prismenkopplung [150, 151].<br />
Hier<strong>bei</strong> wird Licht mit Hilfe eines hochbrechenden Prismas auf eine angrenzende, optisch<br />
dünnere Schicht gestrahlt. Unter bestimmten Einfallswinkeln koppelt ein Teil des Lichtes<br />
in die Schicht ein und wird in dieser nach dem Prinzip der Lichtwellenleitung geleitet.<br />
Das in Reflexion aus dem Prisma austretende Licht zeigt an den Winkelpositionen der<br />
Einkopplung scharfe Intensitätseinbrüche in Form von Dunkellinien, welche als Moden be-<br />
zeichnet werden. Die Position der Moden im Winkelspektrum ist <strong>bei</strong> anisotropen Schichten<br />
abhängig von der Polarisation des verwendeten Messlichts. Im Falle einer Lichteinkopp-<br />
lung sind die effektiven Brechungsindizes Neff = nPrisma·sinαPrisma = nSchicht·sinαSchicht<br />
in <strong>bei</strong>den Medien identisch. Aus den Modenwinkeln lassen sich anschließend die Schichtdi-<br />
cke und die optischen Größen berechnen. Je nach Methode werden hierfür unterschiedliche<br />
mathematische Modell herangezogen.<br />
m-Linienspektroskopie Die Charakterisierung der Azoschichten hinsichtlich Schicht-<br />
dicke und Brechungsindizes erfolgte mit der Methode der m-Linienspektroskopie [87, 96,<br />
152]. Der verwendete Messaufbau ist schematisch in Abbildung 3.1 gezeigt. Das Licht eines<br />
HeNe-Lasers (λ =632, 8 nm) passiert zunächst einen Linearpolarisator, dann eine Blende<br />
und trifft unter einem Winkel α auf die Hypothenusenseite eines hochbrechenden Ein-<br />
koppelprismas (nPrisma =1, 83957) [88]. Eine Schraube presst den Polymerfilm an dessen<br />
hintere Kathetenseite, wodurch der Abstand zwischen Polymerfilm und Prisma verringert<br />
wird und eine gekrümmte Kontaktfläche entsteht. Staubpartikel und Oberflächenuneben-<br />
heiten sorgen dafür, dass sich eine minimale Luftschicht zwischen <strong>bei</strong>den Kontaktflächen<br />
bildet. In dieser Anordnung bilden Prisma, Luftspalt, Polymerschicht und Substrat ein<br />
4-Schichtsystem (nPrisma >nFilm >nSubstrat >nLuft), in dem das Messlicht im Allge-<br />
meinen schon an der Grenzfläche Prisma/ Luftspalt durch Totalreflexion reflektiert wird.<br />
Der Luftspalt kann hier<strong>bei</strong> als Tunnelbarriere angesehen werden, dessen Breite durch<br />
den Anpressdruck variiert wird. Für den Fall, dass die Wellenvektoren im Prisma und<br />
der Polymerschicht übereinstimmen, koppelt das Licht über das evaneszente Feld in den