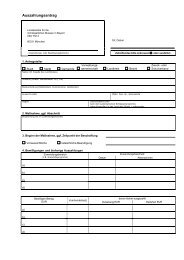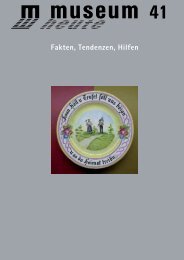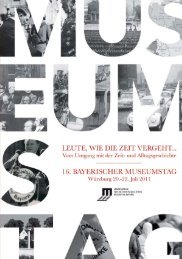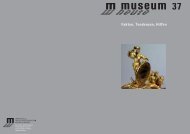29997 Umschlag - Museen in Bayern
29997 Umschlag - Museen in Bayern
29997 Umschlag - Museen in Bayern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
52<br />
BERICHTE/AKTUELLES<br />
VERANSTALTUNGEN RUND UM DIE<br />
FREILICHTMUSEEN<br />
JAHRESTREFFEN DES ARBEITSKREISES<br />
FÜR HAUSFORSCHUNG IN BAYERN<br />
Landshut 19.6.2002<br />
Beim Treffen des Arbeitskreises für Hausforschung <strong>in</strong><br />
<strong>Bayern</strong>, traditionell organisiert vom Referat Freilichtmuseum<br />
der Landesstelle, kamen am 19.6.2002 wieder etwa<br />
60 Spezialisten zusammen. Tagungsort war der sogenannte<br />
Landshuter Salzstadel, e<strong>in</strong> spätmittelalterlicher<br />
Blankziegelbau unweit des Rathauses, der – vor wenigen<br />
Jahren für kulturelle Nutzungen aufwendig saniert – den<br />
passenden Rahmen für die Fachvorträge bot.<br />
Nach der Begrüßung durch Maximilian Seefelder, Heimatpfleger<br />
des Bezirks Niederbayern, und Landshuts<br />
2. Bürgermeister Jakob Endholzner setzte der Vortragsteil<br />
mit e<strong>in</strong>em Beitrag von Dr. Günter Knesch mit Beobachtungen<br />
zu Ziegelmauerwerk und Dachziegeln an zwei<br />
kunsthistorisch hochrangigen Kirchenbauten des Spätmittelalters<br />
<strong>in</strong> Niederbayern e<strong>in</strong>: St. Jakob <strong>in</strong> Straub<strong>in</strong>g<br />
und St. Mart<strong>in</strong> <strong>in</strong> Landshut. Knesch gab e<strong>in</strong>en Überblick<br />
zu den Schadenskartierungen an St. Jakob im Zuge der<br />
Sanierungsvorbereitungen. Die Dokumentation des<br />
Schadensbildes erfolgte <strong>in</strong> Kooperation mit dem m<strong>in</strong>eralischen<br />
Institut der Universität Halle.<br />
Die Untersuchungen an der historischen E<strong>in</strong>deckung von<br />
St. Mart<strong>in</strong> standen im Zusammenhang mit der jüngst erfolgten<br />
Neue<strong>in</strong>deckung der etwa 4.000 m 2 umfassenden<br />
Dachflächen. Das meiste Material stammte aus e<strong>in</strong>er Umdeckung<br />
vom Jahr 1927. Wie bei der Frauenkirche <strong>in</strong><br />
München entschied man sich bei der Neue<strong>in</strong>deckung für<br />
die sogenannte Mönchpfanne, die mit e<strong>in</strong>er federnden<br />
Klammer aus Edelstahl an der Lattung befestigt wurde.<br />
Traditionsgemäß erhielten e<strong>in</strong>ige der neuen Dachziegel<br />
Inschriften, so beispielsweise „Sonnenf<strong>in</strong>sternis 11. August<br />
1999“. Zu beiden Sanierungen hat der Vortragende<br />
handliche Publikationen verfasst.<br />
Dipl. Ing. Michael Back, Memmelsdorf bei Bamberg, referierte<br />
über die bisherigen Forschungsergebnisse bei der<br />
Datierung von Ziegeln und Mörtelproben mithilfe zweier<br />
archäometrischer Verfahren: der Thermolum<strong>in</strong>eszenz an<br />
Ziegeln und der optisch <strong>in</strong>dizierten Lum<strong>in</strong>eszenz an Mörtelproben.<br />
Diese naturwissenschaftlichen Analysen hatte<br />
das hierfür renommierte Rathgen-Forschungslabor der<br />
Stiftung Preußischer Kulturbesitz <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> vorgenommen.<br />
Fünf von sieben mittelalterlichen Kemenatenbauten <strong>in</strong><br />
Bamberg waren auf diese Weise datiert worden. Hierbei<br />
hatten sich Intervalldatierungen <strong>in</strong> der Größenordnung<br />
von etwa 30 bis 100 Jahren ergeben. Drei dieser Bauten<br />
konnten zusätzlich dendrochronologisch bestimmt werden.<br />
Vergleicht man nun die Datierungen der unterschiedlichen<br />
Baumaterialien, so zeigt sich, dass die Intervalle<br />
aus der Thermolum<strong>in</strong>eszenz-Methode <strong>in</strong> allen Fällen nahe<br />
an den Dendrodaten liegen: Ihr Mittelwert bef<strong>in</strong>det<br />
sich lediglich zwischen 13 und 38 Jahre von den jeweiligen<br />
Holzaltersbestimmungen entfernt. Die Ziegel zu den<br />
angesprochenen Kemenaten aus der Zeit zwischen 1292<br />
und 1392 kamen aus den Öfen zweier Ziegelhütten, die<br />
sich auf dem Gebiet der heutigen Innenstadt Bambergs<br />
befanden. Archivalisch s<strong>in</strong>d sie erstmals 1315 bzw. 1367<br />
zu fassen, der Betrieb sche<strong>in</strong>t im späteren 16. Jahrhundert<br />
e<strong>in</strong>gestellt worden zu se<strong>in</strong>.<br />
Florian Eibl M. A. lieferte mit se<strong>in</strong>er Darstellung zur Typologie<br />
und Chronologie mittelalterlicher und neuzeitlicher<br />
flacher Dachziegel <strong>in</strong> Niederbayern e<strong>in</strong>en weiteren Beitrag<br />
zur Thematik der Ziegelproduktion und -verwendung,<br />
diesmal aus dem Bereich der Archäologie: Eibl<br />
stützte sich im Wesentlichen auf meist stark fragmentierte<br />
Funde und Fundkomplexe, wie sie oftmals <strong>in</strong> Gewölbezwickeln<br />
oder im Zusammenhang mit Bauschutt anzutreffen<br />
s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e stratigraphische Datierung solcher<br />
Dachziegel und Dachziegelfragmente scheidet aufgrund<br />
des Lesefundcharakters meist aus, so dass sich hier der<br />
Umweg über die Entwicklung von Typenreihen zur zeitlichen<br />
Grobordnung anbietet. Diese Arbeit hat Eibl mit e<strong>in</strong>em<br />
Teilbestand von 427 Flachziegeln aus e<strong>in</strong>em Gesamtfundus<br />
von etwa 2.000 Dachziegeln an 14 Fundorten<br />
unternommen. In e<strong>in</strong>er vorläufigen Übersicht ersche<strong>in</strong>t<br />
der bearbeitete Bestand <strong>in</strong> fünf Gruppen gegliedert, wobei<br />
die zeitliche E<strong>in</strong>ordnung mit den spitz zulaufenden<br />
Exemplaren im 13. Jahrhundert e<strong>in</strong>setzt und bei den segmentbogig<br />
abschließenden Biberschwanzformen im<br />
20. Jahrhundert endet. Besonderes Augenmerk richtete<br />
der Vortragende bei se<strong>in</strong>er Analyse auf formale Kriterien<br />
wie die Ausbildung der sogenannten Nase oder das<br />
Oberflächenrelief sowie die aus detaillierter Beobachtung<br />
gewonnenen Indizien für den jeweiligen Herstellungsvorgang.<br />
In e<strong>in</strong>drucksvoller Weise gelang es Eibl dabei, die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Schritte <strong>in</strong> der handwerklichen Produktion exakt<br />
nachzuzeichnen: e<strong>in</strong> überzeugendes Beispiel für den<br />
Gew<strong>in</strong>n, den die historische Bauforschung aus der <strong>in</strong> der<br />
Archäologie durchaus gängigen Nahsicht auf die Spuren<br />
an baulichen Überresten zu ziehen vermag.<br />
Dipl. Ing Günter Naumann, Regensburg, stellte im Anschluss<br />
die Ergebnisse der bauhistorischen Untersuchung<br />
e<strong>in</strong>es ehemaligen Hafnerhauses aus dem späten<br />
18. Jahrhundert <strong>in</strong> der Altstadt von Nabburg vor. Das<br />
Haus, das sich bis 1993 nahezu 200 Jahre lang im Besitz<br />
e<strong>in</strong>er Familie befunden hatte, weist e<strong>in</strong>e Reihe ungewöhnlicher<br />
Befunde auf. So s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> dem Gebäude, das <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>er Struktur weitgehend dem Gründungsbau von 1799<br />
entspricht, die grundlegenden Betriebsabläufe der Kera-