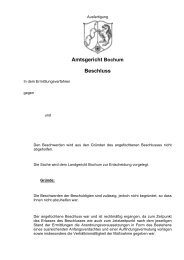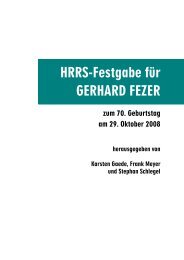HRRS Ausgabe 5/2013 - hrr-strafrecht.de
HRRS Ausgabe 5/2013 - hrr-strafrecht.de
HRRS Ausgabe 5/2013 - hrr-strafrecht.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aufsätze und Anmerkungen<br />
von <strong>de</strong>r Me<strong>de</strong>n – Zur Verfassungswidrigkeit <strong>de</strong>r Auslegung <strong>de</strong>s Sittenwidrigkeitsbegriffs i.S.d. § 228 StGB<br />
haupt noch verfassungskonform ausgelegt wer<strong>de</strong>n können<br />
– die schwere Folge die <strong>strafrecht</strong>liche Haftung einschränken<br />
können. Dies ist nicht <strong>de</strong>r Fall, wenn ihr in<br />
keinem <strong>de</strong>nkbaren Fall eine eigenständige strafbarkeitsbegrün<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
Funktion zukommt. Denn dann wür<strong>de</strong> die<br />
vom <strong>de</strong>mokratisch legitimierten Gesetzgeber getroffene<br />
Entscheidung konterkariert, wonach nicht je<strong>de</strong> Teilnahme<br />
an einer Schlägerei strafbar sein soll. Man mag diese<br />
Strafbarkeitslücke aus rechtpolitischen Grün<strong>de</strong>n für<br />
falsch halten. Aber <strong>de</strong>r fragmentarische Charakter <strong>de</strong>s<br />
Strafrechts ist Ausdruck <strong>de</strong>s verfassungsrechtlich verbürgten<br />
Bestimmtheitsgebots, und <strong>de</strong>r Gesetzgeber hat<br />
bisher keine Veranlassung gesehen, die objektive Bedingung<br />
<strong>de</strong>r Strafbarkeit zu streichen.<br />
Das BVerfG hat in seinen jüngsten Entscheidungen zur<br />
Vereinbarkeit von § 266 StGB mit Art. 103 II GG wie<strong>de</strong>rholt<br />
darauf hingewiesen, dass die Rechtsprechung Begriffe,<br />
die aufgrund ihrer Weite in Konflikt mit <strong>de</strong>m Bestimmtheitsgebot<br />
geraten können, verfassungskonform<br />
so auszulegen hat, dass je<strong>de</strong>m Tatbestandsmerkmal eine<br />
eigenständige strafbarkeitsbegrenzen<strong>de</strong> Funktion erhalten<br />
bleibt. 44 Diese Rechtsprechung muss auch auf das<br />
Verhältnis von zwei unterschiedlichen Tatbestän<strong>de</strong>n<br />
übertragen wer<strong>de</strong>n, insbeson<strong>de</strong>re wenn sie dasselbe<br />
Rechtsgut schützen. Denn das Bestimmtheitsgebot kann<br />
nicht nur dadurch verletzt wer<strong>de</strong>n, dass innerhalb eines<br />
Tatbestan<strong>de</strong>s ein Tatbestandsmerkmal so ausgelegt wird,<br />
dass es in einem an<strong>de</strong>ren aufgeht, son<strong>de</strong>rn auch dadurch,<br />
dass eine bestimmte Auslegung einem an<strong>de</strong>ren Tatbestand<br />
keinen eigenständigen Anwendungsbereich mehr<br />
belässt. Die verfassungsrechtlichen Konsequenzen sind<br />
i<strong>de</strong>ntisch. In bei<strong>de</strong>n Fällen erweitert die Rechtsprechung<br />
– und nicht die Legislative – <strong>de</strong>n Bereich strafbaren Verhaltens,<br />
in<strong>de</strong>m sie eine vom Gesetzgeber aufgestellte<br />
Einschränkung <strong>de</strong>r Strafbarkeit ignoriert. Es ist aber<br />
Aufgabe <strong>de</strong>s <strong>de</strong>mokratisch legitimierten Gesetzgebers,<br />
die Schranken <strong>de</strong>s Erlaubten zu <strong>de</strong>finieren. 45 Das Bestimmtheitsgebot<br />
<strong>de</strong>s Art. 103 II GG enthält neben seiner<br />
freiheitsschützen<strong>de</strong>n Funktion, die es <strong>de</strong>m Normunterworfenen<br />
ermöglichen soll, <strong>strafrecht</strong>liche Sanktionen<br />
vorauszusehen, auch einen strengen Gesetzesvorbehalt,<br />
<strong>de</strong>r nur <strong>de</strong>m Gesetzgeber die Befugnis einräumt,<br />
Verhalten zu kriminalisieren. 46<br />
Dagegen lässt sich auch nicht anführen, dass es sich bei<br />
<strong>de</strong>r Einwilligung um einen Rechtfertigungsgrund han<strong>de</strong>le,<br />
für <strong>de</strong>n das Bestimmtheitsgebot nicht gelte. Unabhängig<br />
davon, dass es sich nach einer im Schrifttum vertretenen<br />
Auffassung bei <strong>de</strong>r Preisgabe von Individualrechtsgütern<br />
durch <strong>de</strong>n Berechtigten schon gar nicht um eine<br />
rechtfertigungsbedürftige Rechtsgutsverletzung, son<strong>de</strong>rn<br />
44<br />
BVerfG NJW 2010, 3209, 3211 = <strong>HRRS</strong> 2010, Nr. 656.<br />
45<br />
BVerfG NJW 1987, 3175; BVerfG NJW 2009, 2267; BVerfG<br />
NJW 2010, 3209, 3211 = <strong>HRRS</strong> 2010, Nr. 656.<br />
46<br />
BVerfG NJW 2009, 2267.<br />
um ein tatbestandsausschließen<strong>de</strong>s Einverständnis han<strong>de</strong>lt,<br />
47 muss je<strong>de</strong>nfalls für Fragen <strong>de</strong>r Einwilligung <strong>de</strong>r<br />
Gesetzgeber das erlaubte Risiko festlegen. Die teilweise<br />
vertretene Auffassung, das Bestimmtheitsgebot gelte<br />
nicht für Erlaubnissätze, 48 kann je<strong>de</strong>nfalls nur dort Geltung<br />
beanspruchen, wo sich <strong>de</strong>r Rechtfertigungsgrund<br />
nicht aus <strong>de</strong>m Gesetz ergibt. 49 Soweit <strong>de</strong>r Rechtfertigungsgrund<br />
selbst im Gesetz – wie hier in § 228 StGB –<br />
grundsätzliche Anerkennung gefun<strong>de</strong>n hat und seine<br />
Grenzen – wie hier durch <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r Sittenwidrigkeit<br />
– ebenfalls durch <strong>de</strong>n <strong>de</strong>mokratisch legitimierten Gesetzgeber<br />
festgelegt wor<strong>de</strong>n sind, darf die Rechtsprechung<br />
nicht die legislative Bestimmung <strong>de</strong>r Strafbarkeitsvoraussetzungen<br />
ignorieren, wie sie hier in § 231 StGB Ausdruck<br />
gefun<strong>de</strong>n hat. Soweit <strong>de</strong>r Gesetzgeber die Grenzen<br />
<strong>de</strong>s erlaubten Risikos mittels eines Rechtfertigungsgrun<strong>de</strong>s<br />
löst, kommt dieser dogmatisch zufälligen Gestaltung<br />
keine geringere Be<strong>de</strong>utung zu als einer expliziten Tatbestandslösung.<br />
In Übereinstimmung mit <strong>de</strong>r herrschen<strong>de</strong>n<br />
Lehre 50 ist <strong>de</strong>shalb davon auszugehen, dass <strong>de</strong>r teilweise<br />
angenommene Rechtfertigungscharakter <strong>de</strong>s § 228 StGB<br />
<strong>de</strong>m Schutz durch das Bestimmtheitsgebot nicht entgegensteht.<br />
V. Zusammenfassung und Ausblick<br />
Das Urteil <strong>de</strong>s 1. Strafsenats zur „dritten Halbzeit“<br />
weicht von <strong>de</strong>r jüngeren Rechtsprechung insbeson<strong>de</strong>re<br />
<strong>de</strong>s 2. und 3. Strafsenats zur Auslegung <strong>de</strong>s Begriffs <strong>de</strong>r<br />
Sittenwidrigkeit ab. Es verletzt das Bestimmtheitsgebot,<br />
weil es <strong>de</strong>m Tatbestand <strong>de</strong>s § 231 StGB keinen eigenständigen<br />
strafbegrün<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Anwendungsbereich belässt.<br />
Auch im Übrigen überzeugt die rechtliche Lösung<br />
<strong>de</strong>s 1. Strafsenats nicht. Es bleibt zu hoffen, dass die<br />
an<strong>de</strong>ren Strafsenate an ihrer bisherigen Rechtsprechung<br />
festhalten wer<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>n Rückfall <strong>de</strong>s 1. Strafsenats in<br />
ein paternalistisches Sittenwidrigkeitsverständnis korrigieren<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Das Strafrecht ist nicht das geeignete Instrumentarium,<br />
um einverständlichen Gewaltexzessen Einhalt zu gebieten.<br />
Natürlich lässt sich die offenkundige Abneigung <strong>de</strong>r<br />
erkennen<strong>de</strong>n Richter gegen einen Freizeitsport <strong>de</strong>s „Sich-<br />
Zusammenschlagens“ gut nachvollziehen. Aber das Strafrecht<br />
schützt allein Rechtgüter. Soweit es um die Verhin<strong>de</strong>rung<br />
öffentlicher Gewalttaten geht, ist das Polizei- und<br />
Ordnungsrecht das richtige Instrumentarium. 51<br />
47<br />
Siehe Fn. 30.<br />
48<br />
Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. (2006), § 5 Rn. 42;<br />
Krey/Esser, Deutsches Strafrecht AT, 5. Aufl. (2012), Rn. 94<br />
und 104 m.w.N.<br />
49<br />
BVerfG NJW 1997, 929, 930.<br />
50<br />
Erb ZStW 108 (1996), 266, 296 f.; Paeffgen, a.a.O. (Fn. 5),<br />
Vorbemerkung §§ 32 ff., Rn. 59 m.w.N.<br />
51<br />
Vgl. Wagner DÖV 2011, 234 ff.<br />
<strong>HRRS</strong> Mai <strong>2013</strong> (5/<strong>2013</strong>)<br />
163