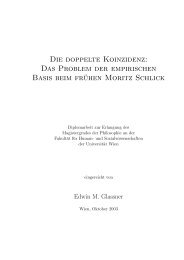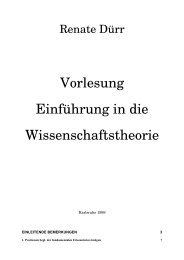PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
31 Handouts zur Vorlesung: STATIONEN <strong>DER</strong> ANTIKEN PHILOSOPHIE: Buchheim: WS 2000/1<br />
SOPHISTIK und ERISTIK<br />
Sophistik bedeutet wörtlich ‚die Kunst, weise zu sein‘ und bezieht sich ursprünglich auf eine Gruppe<br />
von Wanderlehrern („Sophisten“) im antiken Griechenland der 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. (mit<br />
zentraler Wirkungsstätte in Athen), welche die damals im Enstehen begriffenen Wissenschaften wie<br />
N<strong>at</strong>urkunde, Medizin, Psychologie, Rhetorik, Gramm<strong>at</strong>ik und Liter<strong>at</strong>urwissenschaft, sowie Rechtsund<br />
Kulturgeschichte mit je verschiedenenen Schwerpunkten selbst betrieben und eklektizistisch zu<br />
einer ‚Technik‘ geschickter Lebensbewältigung unter Bedingungen der (insbes. demokr<strong>at</strong>ischen) Polis<br />
zu verbinden suchten, um sie gegen Bezahlung an Hörer oder sie begleitende Schüler zu vermitteln.<br />
Cic. (de or. 3, 57) bezeichnet sie deshalb als „vivendi praeceptores“, Plut. (vit. par. Them. 2) als<br />
„Leute, die politisches Geschick und Handlungswissen mit forensischen Künsten verbanden und vom<br />
Feld bloßer Praxis in die Theorie überführten“. Ähnlich kennzeichnete Protagoras selbst, der als<br />
berühmtester Vertreter der S. gilt, nach Pl<strong>at</strong>. (im Dialog Prot.) seine Profession als „politische Kunst“<br />
(319a), „Wohlber<strong>at</strong>enheit“ (318e) oder einfach „Tugend“ (327a). Das wichtigste Mittel, ihre Kunst<br />
auszuüben, das die S. deshalb auch nach allen Richtungen erforschte und system<strong>at</strong>isierte, ist die<br />
Sprache. Denn sie vermag, wie der zweite Hauptvertreter der S., Gorgias von Leontinoi, in seinem<br />
‚Lob der Helena‘ sagt, die Seelen der Hörer durch Überzeugungen und Affekte unmittelbar zu prägen<br />
und zu entsprechendem Handeln zu veranlassen (DK 82 B 11, 8-13). Sophistisches Wirken und<br />
Unterrichten h<strong>at</strong> infolgedessen mehr den Charakter von rhetorischer Artistik (bes. <strong>bei</strong> Gorgias) oder<br />
von methodisch aufbereitetem Redegefecht und topisch-antilogischem Training (bes. <strong>bei</strong> Protagoras,<br />
vgl. auch die anon. ‚Dissoi logoi‘ DK 90) als den der r<strong>at</strong>ionalen Argument<strong>at</strong>ion und selbstkritischen<br />
Wissensvermittlung. Die S. wurde deshalb bereits von der zeitgenössischen Philosophie (s. bes. Pl<strong>at</strong>.<br />
soph. 233c, 268c und Aristot. metap. 1004b 17 ff. und SE 165a 21 ff.) als bloßes „Scheinwissen“<br />
abgelehnt. Die wichtigsten Errungenschaften und Theoreme der S. sind der S<strong>at</strong>z des Protagoras vom<br />
Menschen als „Maß aller Dinge“ (DK 80 B 1), die Begründung der Rhetorik durch Gorgias sowie der<br />
semantischen Analyse in Absicht auf „Richtigkeit der Worte“ durch Prodikos von Keos (DK 84 A 11<br />
ff.); ferner die Erfindung des (ideengeschichtlichen) Lexikons durch Hippias von Elis (DK 86 B 6) und<br />
die Kritik des Rechts vor dem Hintergrund der N<strong>at</strong>ur des Menschen (sog. ‚Nomos-Physis-<br />
Kontroverse‘) durch den Sophisten Antiphon (DK 87 B 44). Bereits mit der zweiten Gener<strong>at</strong>ion von<br />
Sophisten-Schülern im 4. Jhdt. stirbt die S. als abgrenzbarer Beruf aus, degeneriert teils zum<br />
Schimpfwort für unsaubere oder irreführende logisch-dialektische Verfahrensweisen (sog.<br />
‚Sophism<strong>at</strong>a‘) und geht teils über in die Lehrstoffe der Rhetorik- oder Philosophenschulen (z. B. <strong>bei</strong><br />
Isokr<strong>at</strong>es), um im römischen Kaiserreich, wenn auch unter fast ausschließlicher Präponderanz<br />
rhetorischer Artistik, als sog. ‚Zweite Sophistik‘ eine Renaissance zu erfahren.<br />
Lit.:<br />
Texte: H. Diels / W. Kranz (Hg.), Die Fragmente der Vorsokr<strong>at</strong>iker, Bd. 2, Berl. 6 1952 repr. || W.<br />
Nestle (Hg.), Die Vorsokr<strong>at</strong>iker, Düsseldorf 4 1956 || Th. Buchheim (Hg.), Gorgias von Leontinoi.<br />
Fragmente, Reden und Testimonien, gr.-dt. mit Komm., Hambg. 1989.<br />
Liter<strong>at</strong>ur: W. Nestle, Vom Mythos zum Logos, Stuttgart 1940 || C. J. Classen, Sophistik, Darmstadt<br />
1976 || G. B. Kerferd, The Sophistic Movement, Cambridge 1981 || Th. Buchheim, Die Sophistik als<br />
Avantgarde normalen Lebens, Hambg.1986 || J. de Romilly, Les grand sophistes dans l‘Athènes de<br />
Périclès, Paris 1988 (engl. Oxford 1992) || G. Anderson, The Second Sophistic. A Cultural<br />
Phenomenon in the Roman Empire, London/N.Y. 1993 || G. B. Kerferd und H. Flashar, Die Sophistik.<br />
In: Ueberweg AntF. 2/1, Basel 1998.<br />
Eristik bedeutet ‚Streitkunst‘ und bezieht sich auf eine von den Sophisten, insbesondere Protagoras (s.<br />
DK 80 B 6; vgl. A 1 u. 21; vgl. Gorgias DK 82 B 11, 13) entwickelte Methodik, in öffentlichen<br />
Wortwechseln und Redegefechten oder schulmäßigen Disput<strong>at</strong>ionen unbedingt, d.h. auch durch<br />
Eins<strong>at</strong>z unsachlicher, bloß das scheinbare Plausibilitätsprofil der Rede betreffender Kunstgriffe, die<br />
Oberhand zu behalten. Typischer Ausdruck der E. ist der für Protagoras bezeugte S<strong>at</strong>z: „die<br />
schwächere Rede zur stärkeren machen“ (Arist. rhet. 1402a 23-29). Wichtigste Kunstregel für die E.<br />
ist es, jede Frage oder Streitsache nach <strong>bei</strong>den gegenteiligen Seiten diskutieren und plausibel machen