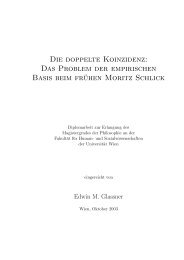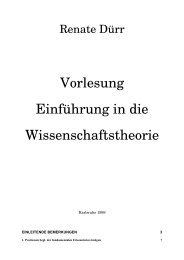PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
37 Handouts zur Vorlesung: STATIONEN <strong>DER</strong> ANTIKEN PHILOSOPHIE: Buchheim: WS 2000/1<br />
somit jedes eines, <strong>bei</strong>de aber zwei sind, dann wird sie die zwei als getrennte (kechôrismena) denkend<br />
erfassen; denn Ungetrenntes erfaßt sie nicht als zwei, sondern als eines. Hingegen h<strong>at</strong> die Sehkraft, wie<br />
wir sagen, ebenfalls Großes und Kleines gesehen, jedoch nicht als getrennt, sondern als etwas Konfuses<br />
(sygkechymena). Durch die deutliche Anzeige (saphêneia) dessen [des Konfusen] wurde also das<br />
Denken gezwungen, das Große und Kleine in den Blick zu fassen (idein ( idea), aber nicht als<br />
konfuse, sondern als abgegrenzte, was im Gegens<strong>at</strong>z steht zu jener [der Wahrnehmung]. Und von da<br />
kam es uns zuerst in den Sinn zu fragen, was das Große und das Kleine eigentlich sei. Und so<br />
bezeichneten wir das eine als denkend zu Erfassendes (noêton), das andere aber als Sichtbares<br />
(hor<strong>at</strong>on).“<br />
Pl<strong>at</strong>on, Parmenides 135 b-c:<br />
„Wenn aber jemand wegen dieser Schwierigkeiten nicht zulassen würde, daß Ideen (eidê) der Dinge<br />
gegeben sind, dann hätte er nichts, worauf sich das Reflektieren (dianoia) beziehen könnte [...] und<br />
würde so die Möglichkeit des dialektischen Untersuchens (dialegesthai) völlig zerstören.“<br />
Zum problem<strong>at</strong>ischen Begriff der Ähnlichkeit zwischen Idee und Erscheinung s. bes. ‚Parmenides‘<br />
132d - 133a.<br />
Der Gedanke der Ähnlichkeit ist durch den des Bildes und der Abbildung zu ersetzen oder zu<br />
ergänzen. Vgl. z.B.<br />
Timaios 52 a-c:<br />
„So ist denn darin übereinzustimmen, daß eines die Idee ist, die sich immer auf dieselbe Weise verhält,<br />
ungeworden und unvergänglich, die weder in sich aufnimmt ein anderes anderswoher noch selbst je in<br />
anderes geht, die unsichtbar und überhaupt nicht wahrnehmbar ist; diese also h<strong>at</strong> das Denken zur<br />
Betrachtung erhalten. Das Gleichnamige und Gleiche mit ihr hingegen ist ein zweites, das wahrzunehmen<br />
und zu erzeugen ist, das immer in Bewegung begriffen ist und sowohl an einem Ort entsteht<br />
als auch wieder von dort verschwindet; das ist durch Meinen im verein mit Wahrnehmung zu erfassen.<br />
Ein drittes aber ist da<strong>bei</strong> immer das Genus des Raumes, das kein Vergehen annimmt, sondern für alles<br />
Werden einen Sitz bereithält, selbst aber nur unter Wahrnehmungsverzicht durch eine zweifelhafte<br />
Überlegung zu fassen ist, kaum zuverlässig. Mit Blick auf dieses Dritte traumwandeln wir und behaupten,<br />
es müsse notwendigerweise überhaupt alles Seiende irgendwo an einem Ort sein und einen Raum<br />
einnehmen, und was weder auf Erden noch am Himmel irgendwo sei, das sei gar nichts. Von diesem<br />
Träume befangen werden wir auch im Wachzustand unfähig, in klarer Unterscheidung von diesem und<br />
allem Verwandten auch über die schlaflose und wahrhaft existierende N<strong>at</strong>ur das Wahre zu sagen: daß<br />
es nämlich einem Bilde zwar - weil es ja auch nicht dies, wozu es geworden ist, aus sich selbst ist,<br />
sondern es stets als ein anschein von etwas anderem getragen wird - deswegen zukommt, in einem<br />
anderen zu entstehen, sich irgendwie festhaltend am Sein, oder aber überhaupt nicht zu sein, daß dem<br />
wirklich Seienden hingegen der durch seine Genauigkeit wahre logos hilft, daß, solange etwas das<br />
eine, das andere aber ein anderes ist, keinesvon <strong>bei</strong>den, als ja in keinem von <strong>bei</strong>den je eins geworden,<br />
zugleich dasselbe und zwei sein wird.“<br />
3. Zum Begriff und der Idee des Guten:<br />
Politeia 505a:<br />
„Du hast wohl schon oft gehört, daß die Idee des Guten das wichtigste Lehrstück (megiston m<strong>at</strong>hêma)<br />
sei, durch welche, wenn man Gerechtes und das andere im Gebrauch hinzunimmt, dieses zu Brauchbarem<br />
und Nützlichem wird“.<br />
Sonnengleichnis (Politeia 506d - 509c):<br />
(506 d) „Was das Gute selbst ist, wollen wir für jetzt sein lassen; denn mehr als mit dem jetzigen<br />
Anlauf zu erreichen ist, scheinen mir schon die Ansichten zu sein, die ich jetzt darüber hege. Was mir