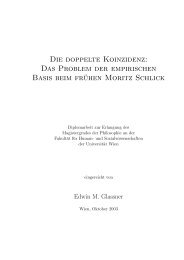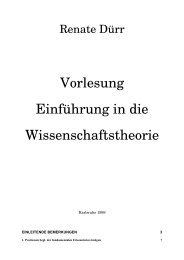PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
71 Handouts zur Vorlesung: STATIONEN <strong>DER</strong> ANTIKEN PHILOSOPHIE: Buchheim: WS 2000/1<br />
insgesamt eine Art Aufstiegsbewegung beschreiben von den Dingen der phänomenalen Welt zur<br />
höchsten und schwierigsten Kontempl<strong>at</strong>ion des Einen am Ende der Leiter. Immerhin gibt Porphyrios<br />
außer der Enneadenfolge auch noch eine chronologische Ordnung der Schriften in seiner Vita Plotini<br />
an. Die hierzulande gebräuchliche Gesamtausgabe Plotins von Richard Harder im Meiner-Verlag<br />
(griechisch-deutsch) folgt dieser chronologischen Ordnung. Zitiert aber wird Plotin nach der Folge der<br />
Enneaden (I - VI), sodann Werkzahl innerhalb der Enneade (1 - 9), anschließend Kapitelzahl und<br />
Zeilenzahl, alles in arabischen Ziffern; zwischen Werkzahl und Kapitel schieben freundliche Leute die<br />
Zählung des Werks nach chronologischer Folge in eckigen Klammern [1 - 54] ein. Am Ende jedes<br />
Textbandes der Harder-Ausgabe findet sich eine Zuordnung der Enneadenliste zur chronologischen<br />
Abfolge, so daß man sich trotz des Wirrwarrs rel<strong>at</strong>iv leicht zurechtfinden kann.<br />
Plotins Hauptlehre besteht in einer Hierarchie von 3 Stufen substantieller Wirklichkeit, den sog.<br />
»Hypostasen«, die auseinander hervorgehen und von der untersten in eine Bildwelt vielfacher,<br />
körperlicher Erscheinung der Dinge ausgebreitet werden, innerhalb derer wir selbst und alles<br />
Wahrnehmbare existieren. Diese drei Hypostasen sind das »Eine« (hen), das jenseits von Sein und<br />
Erkennen der Ursprung von allem ist, zweitens der »Geist« (nous), der in seiner Selbsterkenntnis<br />
zugleich die Vielheit der Ideen wie ein Spektrum seines Wissens umgreift, welches Wissen schließlich<br />
für die dritte Hypostase - nämlich die »Seele« (psychê) - als Anleitung zur tätigen Einbildung der Ideen<br />
in die M<strong>at</strong>erie oder das Nichtseiende dient, so daß an ihr, der M<strong>at</strong>erie, die Körper sozusagen als letzter<br />
Abglanz des Seins in Erscheinung treten.<br />
Jede der Hypostasen, dem Maß ihrer Vollkommenheit entsprechend, hält nicht an sich mit ihrem Sein,<br />
als wäre es gleichsam knapp, sondern fließt über vor Güte, ohne dadurch vermindert zu werden (die<br />
sog. »Eman<strong>at</strong>ion«), wodurch jeweils das nach ihr Kommende als solch ein Abfluß erzeugt wird. Dieser<br />
ist wiederum umso mehr seinem Ursprung ähnlich, als er auch selbst noch etwas über sich Hinausgehendes<br />
freisetzt, so daß der letztlich allem am Sein teilgebende Ursprung - das Eine - als bonum<br />
diffusivum sui aufzufassen ist, - ein Gedanke, der schon auf Pl<strong>at</strong>on (z.B. den Timaios) zurückweist.<br />
Der Weg oder Aufstieg zur Erkenntnis des Einen beginnt indessen n<strong>at</strong>ürlich nicht <strong>bei</strong> diesem, sondern<br />
umgekehrt <strong>bei</strong> uns als befangene in der körperlichen Erscheinung. So müssen wir uns also zunächst in<br />
uns selbst zurückwenden, d.h. unserer Seele zuwenden, denn sie ist der uns gegebene Anknüpfungspunkt<br />
für einen weiteren Aufstieg durch die Hypostasen. So könnte man den Weg der Enneaden des<br />
Plotin beginnen lassen mit seiner Aufforderung zum Rückstieg in uns selbst:<br />
„Geh‘ zurück zu dir selbst und sieh (anage epi sauton kai ide)“ (Enn. I 6 [1] 9,7).<br />
Im weiteren Verlauf des Aufstiegs würde dann die Mannigfaltigkeit und Vielheit der Dinge und<br />
Phänomene immer mehr entkleidet werden bis hin zu ihrem Prinzip, das nur noch es ist, eben dem<br />
Einen, das schließlich erfaßt wird durch den R<strong>at</strong> Plotins:<br />
„Laß alles fort (aphele panta)“ (Enn. V 3 [49] 17,38).<br />
Ein paar wenige Stellen sollen die Hypostasen- und Eman<strong>at</strong>ionslogik Plotins etwas näher illustrieren:<br />
Enn. V 1 [10] 6,34 - 7,41:<br />
„Wie nun und was muß man denken [<strong>bei</strong> der Eman<strong>at</strong>ion]? Es [das Hervorgehende] ist ein um jenes<br />
herum Seiendes, ein Strahlenkranz aus ihm, während aber dieses [bewegungslos] beharrt (menei). Wie<br />
der Glanz um die Sonne sich ausbreitet und ständig aus ihr erzeugt wird, während sie beharrt. Sogar<br />
alle Dinge, solange sie beharren, geben aus ihrer Substanz notwendig die Wirklichkeit (hypostasis) um<br />
sie herum nach außen ab, die abhängt von der Gegenwart ihrer Kraft und wie ein Bild der Archetypen<br />
ist, aus denen sie herauswächst. Feuer etwa die von ihm kommende Wärme; auch Schnee hält die<br />
Kälte nicht nur in sich fest; besonders aber, was gut riecht, bezeugt diesen Sachverhalt, denn solange<br />
es ist, geht etwas daraus hervor in die Umgebung, wovon die Nahestehenden profitieren. Und überhaupt<br />
alles, was bereits vollendet ist, zeugt; was aber immer vollendet ist, zeugt immer und ein Ewiges;<br />
und zwar zeugt es ein Geringeres als es selbst. Was soll man also vom Allervollendetsten sagen?