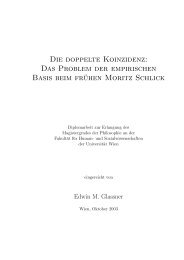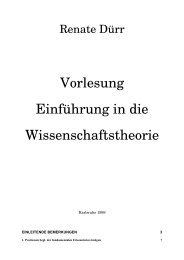PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
61 Handouts zur Vorlesung: STATIONEN <strong>DER</strong> ANTIKEN PHILOSOPHIE: Buchheim: WS 2000/1<br />
haupt zur positiv behaupteten Gewißheit wurde. Arkusilaos ist vor allem dafür bekannt, daß er mit<br />
einem reichhaltigen Arsenal von Argument<strong>at</strong>ionskunst (dilemm<strong>at</strong>ische Hörner, paradoxe Lügner, der<br />
sog. »Sorites« [d.h. ‚Haufenargument‘: ab dem wievielten Gerstenkorn liegt ein Haufen vor?] u.a.) seine<br />
Gegner in die Aparallaxie trieb, d.h. das Zugeständnis erzwang, daß es keine der Wahrheit entsprechende<br />
Vorstellung geben könne, für die man sich nicht eine haargenau gleiche denken kann, die<br />
jedoch falsch ist. Dies bedeutet, daß Wahrheit oder Falschheit generell kein inhaltlich kenntliches<br />
Merkmal von Vorstellungen sein und jede innere Kohärenz sich noch einmal als falsch herausstellen<br />
kann. Deshalb muß man sich in bezug auf alles skeptisch des Urteils über die Wahrheit enthalten. Was<br />
allerdings die praktische Existenz und das Handeln betrifft, für das gewisse Überzeugungen unabdingbar<br />
zu sein scheinen, so propagierte Arkusilaos das sozusagen »weiche« R<strong>at</strong>ionalitätskriterium des<br />
„vernünftig Zurechtgelegten“ (eulogon), an das man sich <strong>bei</strong>m Handeln zu halten habe und durch das<br />
man sogar die Glückseligkeit erreichen könne.<br />
Der zweite Hauptvertreter der akademischen Skepsis war Karneades, der über mannigfache Perfektionierungen<br />
der skeptischen Dialektik und die Entwicklung einer gemäßigten Erkenntnistheorie hinaus<br />
vor allem das »in utramque partem disserere« (nach <strong>bei</strong>den Seiten diskutieren) übte und als eine der<br />
Hauptfiguren unter den Abgesandten der Athener Philosophieschulen nach Rom im Jahr 155 v. Chr.<br />
den alten C<strong>at</strong>o Censorinus zur Weißglut trieb, als er diese Kunst an dem einen Tag contra und am<br />
nächsten pro der Gerechtigkeit auch wirklich vorführte. Noch Cicero, bereits nach der Redogm<strong>at</strong>isierung<br />
der Akademie durch Antiochus von Askalon, bekannte sich als akademischer Skeptiker,<br />
obwohl seine geistige Kompromißbereitschaft und seine auch der Stoa und ihren Idealen geltende<br />
generelle Bewunderung der griechischen Philosophie ihn als nicht völlig einschlägig erscheinen lassen.<br />
Ein längerer Text <strong>bei</strong> Sextus (adv.m<strong>at</strong>h. VII, 150-158) stellt die zentrale Kritik des Arkusilaos an der<br />
Stoischen Erkenntnistheorie (Zenonischer Provenienz) dar und zeigt zugleich seinen Ausweg im Feld<br />
der Praxis mit dem Begriff des eulogon auf:<br />
„Die Stoiker sagen, daß folgende 3 Stufen [der Erkenntnis] miteinander verbunden seien: Wissenschaft<br />
(epistêmê), Meinung (doxa) und Wahrheitserfassung (k<strong>at</strong>alêpsis). Von ihnen sei das Wissen eine<br />
unfehlbare, gewisse und durch kein Argument erschütterbare Wahrheitserfassung; die Meinung hingegen<br />
eine schwache und [möglicherweise] falsche Zustimmung zu etwas; während die Wahrheitserfassung,<br />
als zwischen ihnen, die Zustimmung zu einer realitätserfassenden Vorstellung (k<strong>at</strong>alêptikê<br />
phantasia) ist. Die realitätserfassende Vorstellung aber ist nach ihnen wahr und von von einer<br />
Beschaffenheit, wie sie nicht einer falschen zukommen könne. Von den aufgezählten Dingen verfügten<br />
allein die Weisen über Wissen, während nur die gewöhnlichen Leute Meinung hätten, aber die<br />
Wahrheitserfassung sei <strong>bei</strong>den gemeinsam - und dies etablieren sie als das Kriterium der Wahrheit.<br />
Diesen Behauptungen seitens der Stoa tritt Arkusilaos entgegen und zeigt: (1) daß die Wahrheitserfassung<br />
keinerlei Kriterium abgibt zwischen Wissen und Meinung. Denn das, was sie Wahrheitserfassung<br />
und Zustimmung zu einer realitätserfassenden Vorstellung nennen, das komme entweder im Weisen<br />
oder im Gewöhnlichen vor. Doch wenn im Weisen, dann ist es Wissen, wenn aber im Gewöhnlichen,<br />
dann ist es Meinung. Etwas Drittes aber gebe es nicht außer den bloßen Worten nach. Wenn aber (2)<br />
die Wahrheiterfassung Zustimmung zur realitätserfassenden Vorstellung ist, dann gibt es das gar nicht<br />
und zwar erstens, weil die Zustimmung nicht zu Vorstellungen, sondern zu Sätzen gegeben werde<br />
(denn Zustimmen beziehe sich auf gehaltene Thesen [axiom<strong>at</strong>a]), zweitens aber deshalb, weil keine<br />
auf solche Weise wahre Vorstellung gefunden werden könne, daß sie nicht auch falsch sein könnte [=<br />
Aparallaxie] - wofür Arkusilaos vielfältige Illustr<strong>at</strong>ionen ins Feld führt. Wenn aber keine realitätserfassende<br />
Vorstellung existiert, dann kommt es (3) auch nicht zu einer Wahrheitserfassung. Wenn es<br />
aber keine Wahrheitserfassung gibt, dann ist alles unerfaßlich (ak<strong>at</strong>alêpta). Wenn aber alles unerfaßlich<br />
sei, folgt, daß (4) auch nach den Stoikern der Weise sich des Urteils enthält. Das sehen wir folgendermaßen:<br />
Nachdem alles unerfaßlich ist, weil es das stoische Kriterium nicht gibt, würde der Weise,<br />
wenn er durch sein Urteil zustimmte, eine Meinung hegen. [...] Denn Zustimmung zum Unerfaßlichen<br />
ist Meinung. Sodaß, wenn der Weise zu denen gehört, die zustimmend urteilen, er auch zu denen<br />
gehört, die Meinungen haben. Aber der Weise gehört [definitionsgemäß s.o.] nicht zu den Leuten, die<br />
Meinungen haben (denn das wäre nach stoischer Auffassung Mangel an Klugheit und Ursache der