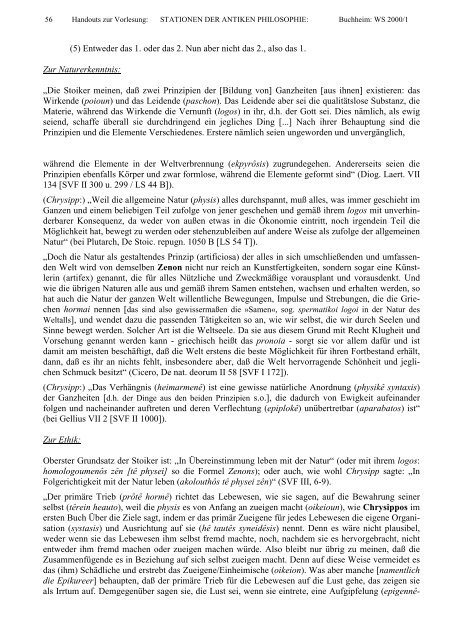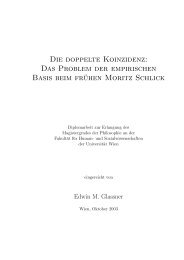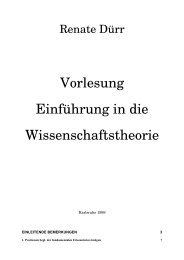PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
56 Handouts zur Vorlesung: STATIONEN <strong>DER</strong> ANTIKEN PHILOSOPHIE: Buchheim: WS 2000/1<br />
(5) Entweder das 1. oder das 2. Nun aber nicht das 2., also das 1.<br />
Zur N<strong>at</strong>urerkenntnis:<br />
„Die Stoiker meinen, daß zwei Prinzipien der [Bildung von] Ganzheiten [aus ihnen] existieren: das<br />
Wirkende (poioun) und das Leidende (paschon). Das Leidende aber sei die qualitätslose Substanz, die<br />
M<strong>at</strong>erie, während das Wirkende die Vernunft (logos) in ihr, d.h. der Gott sei. Dies nämlich, als ewig<br />
seiend, schaffe überall sie durchdringend ein jegliches Ding [...] Nach ihrer Behauptung sind die<br />
Prinzipien und die Elemente Verschiedenes. Erstere nämlich seien ungeworden und unvergänglich,<br />
während die Elemente in der Weltverbrennung (ekpyrôsis) zugrundegehen. Andererseits seien die<br />
Prinzipien ebenfalls Körper und zwar formlose, während die Elemente geformt sind“ (Diog. Laert. VII<br />
134 [SVF II 300 u. 299 / LS 44 B]).<br />
(Chrysipp:) „Weil die allgemeine N<strong>at</strong>ur (physis) alles durchspannt, muß alles, was immer geschieht im<br />
Ganzen und einem beliebigen Teil zufolge von jener geschehen und gemäß ihrem logos mit unverhinderbarer<br />
Konsequenz, da weder von außen etwas in die Ökonomie eintritt, noch irgendein Teil die<br />
Möglichkeit h<strong>at</strong>, bewegt zu werden oder stehenzubleiben auf andere Weise als zufolge der allgemeinen<br />
N<strong>at</strong>ur“ (<strong>bei</strong> Plutarch, De Stoic. repugn. 1050 B [LS 54 T]).<br />
„Doch die N<strong>at</strong>ur als gestaltendes Prinzip (artificiosa) der alles in sich umschließenden und umfassenden<br />
Welt wird von demselben Zenon nicht nur reich an Kunstfertigkeiten, sondern sogar eine Künstlerin<br />
(artifex) genannt, die für alles Nützliche und Zweckmäßige vorausplant und vorausdenkt. Und<br />
wie die übrigen N<strong>at</strong>uren alle aus und gemäß ihrem Samen entstehen, wachsen und erhalten werden, so<br />
h<strong>at</strong> auch die N<strong>at</strong>ur der ganzen Welt willentliche Bewegungen, Impulse und Strebungen, die die Griechen<br />
hormai nennen [das sind also gewissermaßen die »Samen«, sog. sperm<strong>at</strong>ikoi logoi in der N<strong>at</strong>ur des<br />
Weltalls], und wendet dazu die passenden Tätigkeiten so an, wie wir selbst, die wir durch Seelen und<br />
Sinne bewegt werden. Solcher Art ist die Weltseele. Da sie aus diesem Grund mit Recht Klugheit und<br />
Vorsehung genannt werden kann - griechisch heißt das pronoia - sorgt sie vor allem dafür und ist<br />
damit am meisten beschäftigt, daß die Welt erstens die beste Möglichkeit für ihren Fortbestand erhält,<br />
dann, daß es ihr an nichts fehlt, insbesondere aber, daß die Welt hervorragende Schönheit und jeglichen<br />
Schmuck besitzt“ (Cicero, De n<strong>at</strong>. deorum II 58 [SVF I 172]).<br />
(Chrysipp:) „Das Verhängnis (heimarmenê) ist eine gewisse n<strong>at</strong>ürliche Anordnung (physikê syntaxis)<br />
der Ganzheiten [d.h. der Dinge aus den <strong>bei</strong>den Prinzipien s.o.], die dadurch von Ewigkeit aufeinander<br />
folgen und nacheinander auftreten und deren Verflechtung (epiplokê) unübertretbar (aparab<strong>at</strong>os) ist“<br />
(<strong>bei</strong> Gellius VII 2 [SVF II 1000]).<br />
Zur Ethik:<br />
Oberster Grunds<strong>at</strong>z der Stoiker ist: „In Übereinstimmung leben mit der N<strong>at</strong>ur“ (oder mit ihrem logos:<br />
homologoumenôs zên [tê physei] so die Formel Zenons); oder auch, wie wohl Chrysipp sagte: „In<br />
Folgerichtigkeit mit der N<strong>at</strong>ur leben (akolouthôs tê physei zên)“ (SVF III, 6-9).<br />
„Der primäre Trieb (prôtê hormê) richtet das Lebewesen, wie sie sagen, auf die Bewahrung seiner<br />
selbst (têrein heauto), weil die physis es von Anfang an zueigen macht (oikeioun), wie Chrysippos im<br />
ersten Buch Über die Ziele sagt, indem er das primär Zueigene für jedes Lebewesen die eigene Organis<strong>at</strong>ion<br />
(systasis) und Ausrichtung auf sie (hê tautês syneidêsis) nennt. Denn es wäre nicht plausibel,<br />
weder wenn sie das Lebewesen ihm selbst fremd machte, noch, nachdem sie es hervorgebracht, nicht<br />
entweder ihm fremd machen oder zueigen machen würde. Also bleibt nur übrig zu meinen, daß die<br />
Zusammenfügende es in Beziehung auf sich selbst zueigen macht. Denn auf diese Weise vermeidet es<br />
das (ihm) Schädliche und erstrebt das Zueigene/Einheimische (oikeion). Was aber manche [namentlich<br />
die Epikureer] behaupten, daß der primäre Trieb für die Lebewesen auf die Lust gehe, das zeigen sie<br />
als Irrtum auf. Demgegenüber sagen sie, die Lust sei, wenn sie eintrete, eine Aufgipfelung (epigennê-