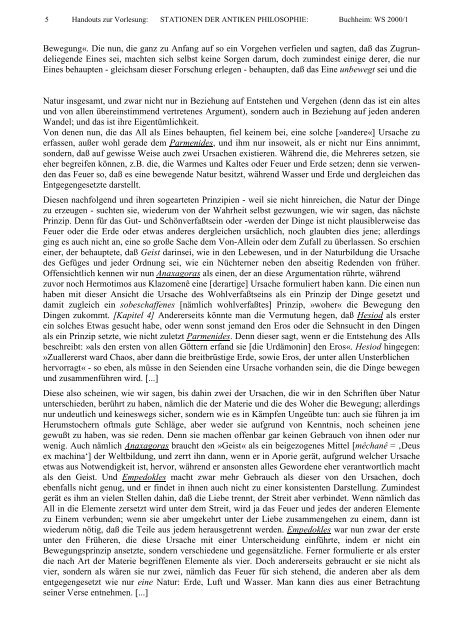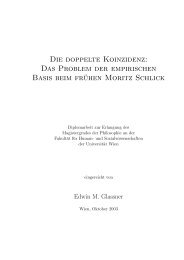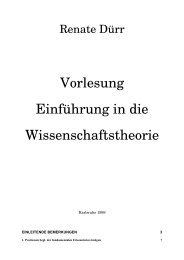PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5 Handouts zur Vorlesung: STATIONEN <strong>DER</strong> ANTIKEN PHILOSOPHIE: Buchheim: WS 2000/1<br />
Bewegung«. Die nun, die ganz zu Anfang auf so ein Vorgehen verfielen und sagten, daß das Zugrundeliegende<br />
Eines sei, machten sich selbst keine Sorgen darum, doch zumindest einige derer, die nur<br />
Eines behaupten - gleichsam dieser Forschung erlegen - behaupten, daß das Eine unbewegt sei und die<br />
N<strong>at</strong>ur insgesamt, und zwar nicht nur in Beziehung auf Entstehen und Vergehen (denn das ist ein altes<br />
und von allen übereinstimmend vertretenes Argument), sondern auch in Beziehung auf jeden anderen<br />
Wandel; und das ist ihre Eigentümlichkeit.<br />
Von denen nun, die das All als Eines behaupten, fiel keinem <strong>bei</strong>, eine solche [»andere«] Ursache zu<br />
erfassen, außer wohl gerade dem Parmenides, und ihm nur insoweit, als er nicht nur Eins annimmt,<br />
sondern, daß auf gewisse Weise auch zwei Ursachen existieren. Während die, die Mehreres setzen, sie<br />
eher begreifen können, z.B. die, die Warmes und Kaltes oder Feuer und Erde setzen; denn sie verwenden<br />
das Feuer so, daß es eine bewegende N<strong>at</strong>ur besitzt, während Wasser und Erde und dergleichen das<br />
Entgegengesetzte darstellt.<br />
Diesen nachfolgend und ihren sogearteten Prinzipien - weil sie nicht hinreichen, die N<strong>at</strong>ur der Dinge<br />
zu erzeugen - suchten sie, wiederum von der Wahrheit selbst gezwungen, wie wir sagen, das nächste<br />
Prinzip. Denn für das Gut- und Schönverfaßtsein oder -werden der Dinge ist nicht plausiblerweise das<br />
Feuer oder die Erde oder etwas anderes dergleichen ursächlich, noch glaubten dies jene; allerdings<br />
ging es auch nicht an, eine so große Sache dem Von-Allein oder dem Zufall zu überlassen. So erschien<br />
einer, der behauptete, daß Geist darinsei, wie in den Lebewesen, und in der N<strong>at</strong>urbildung die Ursache<br />
des Gefüges und jeder Ordnung sei, wie ein Nüchterner neben den abseitig Redenden von früher.<br />
Offensichtlich kennen wir nun Anaxagoras als einen, der an diese Argument<strong>at</strong>ion rührte, während<br />
zuvor noch Hermotimos aus Klazomenê eine [derartige] Ursache formuliert haben kann. Die einen nun<br />
haben mit dieser Ansicht die Ursache des Wohlverfaßtseins als ein Prinzip der Dinge gesetzt und<br />
damit zugleich ein sobeschaffenes [nämlich wohlverfaßtes] Prinzip, »woher« die Bewegung den<br />
Dingen zukommt. [Kapitel 4] Andererseits könnte man die Vermutung hegen, daß Hesiod als erster<br />
ein solches Etwas gesucht habe, oder wenn sonst jemand den Eros oder die Sehnsucht in den Dingen<br />
als ein Prinzip setzte, wie nicht zuletzt Parmenides. Denn dieser sagt, wenn er die Entstehung des Alls<br />
beschreibt: »als den ersten von allen Göttern erfand sie [die Urdämonin] den Eros«. Hesiod hingegen:<br />
»Zuallererst ward Chaos, aber dann die breitbrüstige Erde, sowie Eros, der unter allen Unsterblichen<br />
hervorragt« - so eben, als müsse in den Seienden eine Ursache vorhanden sein, die die Dinge bewegen<br />
und zusammenführen wird. [...]<br />
Diese also scheinen, wie wir sagen, bis dahin zwei der Ursachen, die wir in den Schriften über N<strong>at</strong>ur<br />
unterschieden, berührt zu haben, nämlich die der M<strong>at</strong>erie und die des Woher die Bewegung; allerdings<br />
nur undeutlich und keineswegs sicher, sondern wie es in Kämpfen Ungeübte tun: auch sie führen ja im<br />
Herumstochern oftmals gute Schläge, aber weder sie aufgrund von Kenntnis, noch scheinen jene<br />
gewußt zu haben, was sie reden. Denn sie machen offenbar gar keinen Gebrauch von ihnen oder nur<br />
wenig. Auch nämlich Anaxagoras braucht den »Geist« als ein <strong>bei</strong>gezogenes Mittel [mêchanê = ‚Deus<br />
ex machina‘] der Weltbildung, und zerrt ihn dann, wenn er in Aporie gerät, aufgrund welcher Ursache<br />
etwas aus Notwendigkeit ist, hervor, während er ansonsten alles Gewordene eher verantwortlich macht<br />
als den Geist. Und Empedokles macht zwar mehr Gebrauch als dieser von den Ursachen, doch<br />
ebenfalls nicht genug, und er findet in ihnen auch nicht zu einer konsistenten Darstellung. Zumindest<br />
gerät es ihm an vielen Stellen dahin, daß die Liebe trennt, der Streit aber verbindet. Wenn nämlich das<br />
All in die Elemente zersetzt wird unter dem Streit, wird ja das Feuer und jedes der anderen Elemente<br />
zu Einem verbunden; wenn sie aber umgekehrt unter der Liebe zusammengehen zu einem, dann ist<br />
wiederum nötig, daß die Teile aus jedem herausgetrennt werden. Empedokles war nun zwar der erste<br />
unter den Früheren, die diese Ursache mit einer Unterscheidung einführte, indem er nicht ein<br />
Bewegungsprinzip ansetzte, sondern verschiedene und gegensätzliche. Ferner formulierte er als erster<br />
die nach Art der M<strong>at</strong>erie begriffenen Elemente als vier. Doch andererseits gebraucht er sie nicht als<br />
vier, sondern als wären sie nur zwei, nämlich das Feuer für sich stehend, die anderen aber als dem<br />
entgegengesetzt wie nur eine N<strong>at</strong>ur: Erde, Luft und Wasser. Man kann dies aus einer Betrachtung<br />
seiner Verse entnehmen. [...]