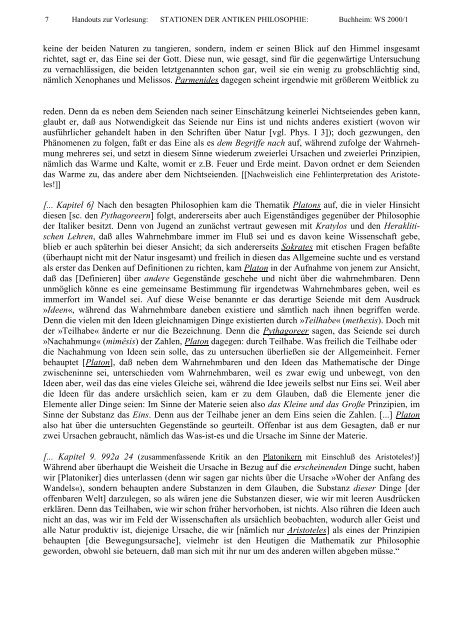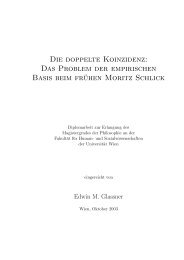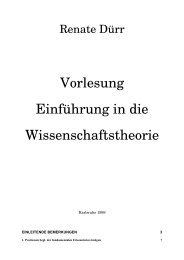PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
7 Handouts zur Vorlesung: STATIONEN <strong>DER</strong> ANTIKEN PHILOSOPHIE: Buchheim: WS 2000/1<br />
keine der <strong>bei</strong>den N<strong>at</strong>uren zu tangieren, sondern, indem er seinen Blick auf den Himmel insgesamt<br />
richtet, sagt er, das Eine sei der Gott. Diese nun, wie gesagt, sind für die gegenwärtige Untersuchung<br />
zu vernachlässigen, die <strong>bei</strong>den letztgenannten schon gar, weil sie ein wenig zu grobschlächtig sind,<br />
nämlich Xenophanes und Melissos. Parmenides dagegen scheint irgendwie mit größerem Weitblick zu<br />
reden. Denn da es neben dem Seienden nach seiner Einschätzung keinerlei Nichtseiendes geben kann,<br />
glaubt er, daß aus Notwendigkeit das Seiende nur Eins ist und nichts anderes existiert (wovon wir<br />
ausführlicher gehandelt haben in den Schriften über N<strong>at</strong>ur [vgl. Phys. I 3]); doch gezwungen, den<br />
Phänomenen zu folgen, faßt er das Eine als es dem Begriffe nach auf, während zufolge der Wahrnehmung<br />
mehreres sei, und setzt in diesem Sinne wiederum zweierlei Ursachen und zweierlei Prinzipien,<br />
nämlich das Warme und Kalte, womit er z.B. Feuer und Erde meint. Davon ordnet er dem Seienden<br />
das Warme zu, das andere aber dem Nichtseienden. [[Nachweislich eine Fehlinterpret<strong>at</strong>ion des Aristoteles!]]<br />
[... Kapitel 6] Nach den besagten Philosophien kam die Them<strong>at</strong>ik Pl<strong>at</strong>ons auf, die in vieler Hinsicht<br />
diesen [sc. den Pythagoreern] folgt, andererseits aber auch Eigenständiges gegenüber der Philosophie<br />
der Italiker besitzt. Denn von Jugend an zunächst vertraut gewesen mit Kr<strong>at</strong>ylos und den Heraklitischen<br />
Lehren, daß alles Wahrnehmbare immer im Fluß sei und es davon keine Wissenschaft gebe,<br />
blieb er auch späterhin <strong>bei</strong> dieser Ansicht; da sich andererseits Sokr<strong>at</strong>es mit etischen Fragen befaßte<br />
(überhaupt nicht mit der N<strong>at</strong>ur insgesamt) und freilich in diesen das Allgemeine suchte und es verstand<br />
als erster das Denken auf Definitionen zu richten, kam Pl<strong>at</strong>on in der Aufnahme von jenem zur Ansicht,<br />
daß das [Definieren] über andere Gegenstände geschehe und nicht über die wahrnehmbaren. Denn<br />
unmöglich könne es eine gemeinsame Bestimmung für irgendetwas Wahrnehmbares geben, weil es<br />
immerfort im Wandel sei. Auf diese Weise benannte er das derartige Seiende mit dem Ausdruck<br />
»Ideen«, während das Wahrnehmbare daneben existiere und sämtlich nach ihnen begriffen werde.<br />
Denn die vielen mit den Ideen gleichnamigen Dinge existierten durch »Teilhabe« (methexis). Doch mit<br />
der »Teilhabe« änderte er nur die Bezeichnung. Denn die Pythagoreer sagen, das Seiende sei durch<br />
»Nachahmung« (mimêsis) der Zahlen, Pl<strong>at</strong>on dagegen: durch Teilhabe. Was freilich die Teilhabe oder<br />
die Nachahmung von Ideen sein solle, das zu untersuchen überließen sie der Allgemeinheit. Ferner<br />
behauptet [Pl<strong>at</strong>on], daß neben dem Wahrnehmbaren und den Ideen das M<strong>at</strong>hem<strong>at</strong>ische der Dinge<br />
zwischeninne sei, unterschieden vom Wahrnehmbaren, weil es zwar ewig und unbewegt, von den<br />
Ideen aber, weil das das eine vieles Gleiche sei, während die Idee jeweils selbst nur Eins sei. Weil aber<br />
die Ideen für das andere ursächlich seien, kam er zu dem Glauben, daß die Elemente jener die<br />
Elemente aller Dinge seien: Im Sinne der M<strong>at</strong>erie seien also das Kleine und das Große Prinzipien, im<br />
Sinne der Substanz das Eins. Denn aus der Teilhabe jener an dem Eins seien die Zahlen. [...] Pl<strong>at</strong>on<br />
also h<strong>at</strong> über die untersuchten Gegenstände so geurteilt. Offenbar ist aus dem Gesagten, daß er nur<br />
zwei Ursachen gebraucht, nämlich das Was-ist-es und die Ursache im Sinne der M<strong>at</strong>erie.<br />
[... Kapitel 9. 992a 24 (zusammenfassende Kritik an den Pl<strong>at</strong>onikern mit Einschluß des Aristoteles!)]<br />
Während aber überhaupt die Weisheit die Ursache in Bezug auf die erscheinenden Dinge sucht, haben<br />
wir [Pl<strong>at</strong>oniker] dies unterlassen (denn wir sagen gar nichts über die Ursache »Woher der Anfang des<br />
Wandels«), sondern behaupten andere Substanzen in dem Glauben, die Substanz dieser Dinge [der<br />
offenbaren Welt] darzulegen, so als wären jene die Substanzen dieser, wie wir mit leeren Ausdrücken<br />
erklären. Denn das Teilhaben, wie wir schon früher hervorhoben, ist nichts. Also rühren die Ideen auch<br />
nicht an das, was wir im Feld der Wissenschaften als ursächlich beobachten, wodurch aller Geist und<br />
alle N<strong>at</strong>ur produktiv ist, diejenige Ursache, die wir [nämlich nur Aristoteles] als eines der Prinzipien<br />
behaupten [die Bewegungsursache], vielmehr ist den Heutigen die M<strong>at</strong>hem<strong>at</strong>ik zur Philosophie<br />
geworden, obwohl sie beteuern, daß man sich mit ihr nur um des anderen willen abgeben müsse.“