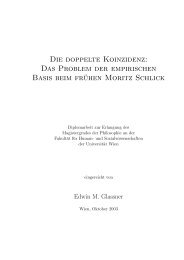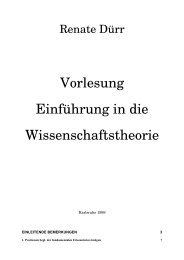PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
64 Handouts zur Vorlesung: STATIONEN <strong>DER</strong> ANTIKEN PHILOSOPHIE: Buchheim: WS 2000/1<br />
F. Ricken: Antike Skeptiker (Beck‘sche Reihe Denker), München 1994<br />
PHILON<br />
Philon von Alexandrien, auch »Philo Judaeus« genannt, lebte von ca. 15 v. Chr. bis 50 n. Chr.<br />
Alexandria war damals neben, vielleicht sogar noch vor Athen das wissenschaftliche Zentrum der<br />
griechischen Welt, mit seiner ungeheuer großen Bibliothek und der blühenden Wirtschaft von ca.<br />
600000 Einwohnern, von denen fast ein Drittel jüdischer Abstammung war. Die jüdische Gemeinde<br />
h<strong>at</strong>te, unter römischer Herrschaft, rel<strong>at</strong>iv große Autonomie, und Philon entstammte einer der reichsten<br />
Familien, deren Mitglieder z.T. auch in römischen Diensten standen oder sogar ihrem Judentum<br />
abschworen, um politisch Karriere zu machen. Philon selbst h<strong>at</strong>te ein hohes Amt in der jüdischen<br />
Gemeinde inne und leitete in dieser Eigenschaft etwa 40 n. Chr. eine Deleg<strong>at</strong>ion nach Rom (zu Kaiser<br />
Caligula), um sich über grassierende antijüdische Ausschreitungen dieser Jahre in Alexandria zu<br />
beklagen.<br />
Philon war und blieb geradezu begeisterter Anhänger des jüdischen Glaubens, wenn auch seine<br />
Sprache und seine gesamte Bildung griechischen Ursprungs war (er konnte kein Hebräisch), d.h. es<br />
handelt sich um ein völlig hellenisiertes Judentum zu dieser Zeit in Alexandria. Dennoch bringt die<br />
religiöse, jüdische Prägung seiner Schriften einen völlig neuartigen Ton in die griechische Philosophie,<br />
der von den christlichen Schriftstellern (wie Origenes, Numenios und Klemens von Alexandrien)<br />
später nachgeahmt wurde und so überhaupt zu einem prägenden Stil christlicher Liter<strong>at</strong>ur und<br />
christlichen Denkens wurde: nämlich die sog. allegorische Interpret<strong>at</strong>ion, die in heiligen Schriften ein<br />
Übermaß an Philosophie und Weisheit letztlich göttlichen Ursprungs entdecken will. Hegel schreibt<br />
dazu treffend: „Beim göttlichen Buch (dessen Urheber der Geist ist) kann man nicht sagen, daß dies<br />
nicht darin gewesen sei. [...] Ein Mann h<strong>at</strong> ein Buch geschrieben, er h<strong>at</strong>te diese Gedanken nicht, aber<br />
im Intensiven des Verhältnisses sind diese Gedanken an sich enthalten. Es ist überhaupt ein großer<br />
Unterschied zwischen dem, was darin liegt, und dem, was ausgesprochen ist. In der ganzen Geschichte,<br />
Kunst, Philosophie usf. kommt es darauf an, daß das, was darin ist, auch heraus sei“ (Bd. 19, S.<br />
420). - Und dies wäre also immerhin das Verdienst Philons, der alle Weisheit der damaligen Welt,<br />
insbes. Pl<strong>at</strong>on und Pythagoras in den 5 Büchern Mose (Pent<strong>at</strong>euch) wiederfindet, von dem aus sie<br />
seiner Meinung nach ihren ursprünglichen Siegeszug auf Erden antr<strong>at</strong>.<br />
Die ganze innige, unbedingte Bindung an die Religion und den persönlichen Gott, der für alles mit<br />
Willen verantwortlich ist (vgl. z.B. De somniis II, 253), was mir vorausgeht, passiert und einleuchtet,<br />
ist für das griechische Denken neu; neu ist, daß Gott transzendente Person und nicht (meistens sogar<br />
immanente) Struktur oder Strukturprinzip ist. Philon nennt ihn »V<strong>at</strong>er« (des Kosmos; wohl auch nach<br />
Pl<strong>at</strong>ons ‚Timaios‘, z.B. De decalogo 134) und ho ôn (neben to on) - »der Seiende« (nach Exodus 3,14:<br />
„ich bin der ich bin“, s. De Abrahamo 119 ff.) und will damit sagen, daß Gott nur in der Zuverlässigkeit<br />
seines Existierens, aber nicht in seinem Wesen erkannt werden kann (damit wird er manchmal<br />
auch für den Erfinder der neg<strong>at</strong>iven Theologie gehalten [vgl. z.B. De posteriorit<strong>at</strong>e Cainii 14], obwohl