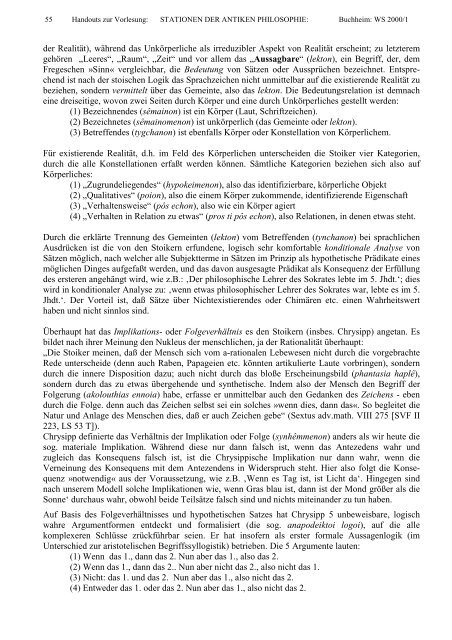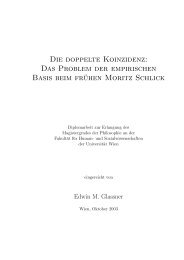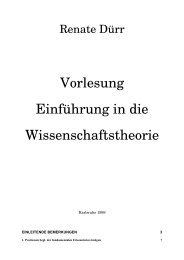PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
PLAN DER VORLESUNG (1) - Sammelpunkt bei philo.at
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
55 Handouts zur Vorlesung: STATIONEN <strong>DER</strong> ANTIKEN PHILOSOPHIE: Buchheim: WS 2000/1<br />
der Realität), während das Unkörperliche als irreduzibler Aspekt von Realität erscheint; zu letzterem<br />
gehören „Leeres“, „Raum“, „Zeit“ und vor allem das „Aussagbare“ (lekton), ein Begriff, der, dem<br />
Fregeschen »Sinn« vergleichbar, die Bedeutung von Sätzen oder Aussprüchen bezeichnet. Entsprechend<br />
ist nach der stoischen Logik das Sprachzeichen nicht unmittelbar auf die existierende Realität zu<br />
beziehen, sondern vermittelt über das Gemeinte, also das lekton. Die Bedeutungsrel<strong>at</strong>ion ist demnach<br />
eine dreiseitige, wovon zwei Seiten durch Körper und eine durch Unkörperliches gestellt werden:<br />
(1) Bezeichnendes (sêmainon) ist ein Körper (Laut, Schriftzeichen).<br />
(2) Bezeichnetes (sêmainomenon) ist unkörperlich (das Gemeinte oder lekton).<br />
(3) Betreffendes (tygchanon) ist ebenfalls Körper oder Konstell<strong>at</strong>ion von Körperlichem.<br />
Für existierende Realität, d.h. im Feld des Körperlichen unterscheiden die Stoiker vier K<strong>at</strong>egorien,<br />
durch die alle Konstell<strong>at</strong>ionen erfaßt werden können. Sämtliche K<strong>at</strong>egorien beziehen sich also auf<br />
Körperliches:<br />
(1) „Zugrundeliegendes“ (hypokeimenon), also das identifizierbare, körperliche Objekt<br />
(2) „Qualit<strong>at</strong>ives“ (poion), also die einem Körper zukommende, identifizierende Eigenschaft<br />
(3) „Verhaltensweise“ (pôs echon), also wie ein Körper agiert<br />
(4) „Verhalten in Rel<strong>at</strong>ion zu etwas“ (pros ti pôs echon), also Rel<strong>at</strong>ionen, in denen etwas steht.<br />
Durch die erklärte Trennung des Gemeinten (lekton) vom Betreffenden (tynchanon) <strong>bei</strong> sprachlichen<br />
Ausdrücken ist die von den Stoikern erfundene, logisch sehr komfortable konditionale Analyse von<br />
Sätzen möglich, nach welcher alle Subjektterme in Sätzen im Prinzip als hypothetische Prädik<strong>at</strong>e eines<br />
möglichen Dinges aufgefaßt werden, und das davon ausgesagte Prädik<strong>at</strong> als Konsequenz der Erfüllung<br />
des ersteren angehängt wird, wie z.B.: ‚Der <strong>philo</strong>sophische Lehrer des Sokr<strong>at</strong>es lebte im 5. Jhdt.‘; dies<br />
wird in konditionaler Analyse zu: ‚wenn etwas <strong>philo</strong>sophischer Lehrer des Sokr<strong>at</strong>es war, lebte es im 5.<br />
Jhdt.‘. Der Vorteil ist, daß Sätze über Nichtexistierendes oder Chimären etc. einen Wahrheitswert<br />
haben und nicht sinnlos sind.<br />
Überhaupt h<strong>at</strong> das Implik<strong>at</strong>ions- oder Folgeverhältnis es den Stoikern (insbes. Chrysipp) angetan. Es<br />
bildet nach ihrer Meinung den Nukleus der menschlichen, ja der R<strong>at</strong>ionalität überhaupt:<br />
„Die Stoiker meinen, daß der Mensch sich vom a-r<strong>at</strong>ionalen Lebewesen nicht durch die vorgebrachte<br />
Rede unterscheide (denn auch Raben, Papageien etc. könnten artikulierte Laute vorbringen), sondern<br />
durch die innere Disposition dazu; auch nicht durch das bloße Erscheinungsbild (phantasia haplê),<br />
sondern durch das zu etwas übergehende und synthetische. Indem also der Mensch den Begriff der<br />
Folgerung (akolouthias ennoia) habe, erfasse er unmittelbar auch den Gedanken des Zeichens - eben<br />
durch die Folge. denn auch das Zeichen selbst sei ein solches »wenn dies, dann das«. So begleitet die<br />
N<strong>at</strong>ur und Anlage des Menschen dies, daß er auch Zeichen gebe“ (Sextus adv.m<strong>at</strong>h. VIII 275 [SVF II<br />
223, LS 53 T]).<br />
Chrysipp definierte das Verhältnis der Implik<strong>at</strong>ion oder Folge (synhêmmenon) anders als wir heute die<br />
sog. m<strong>at</strong>eriale Implik<strong>at</strong>ion. Während diese nur dann falsch ist, wenn das Antezedens wahr und<br />
zugleich das Konsequens falsch ist, ist die Chrysippische Implik<strong>at</strong>ion nur dann wahr, wenn die<br />
Verneinung des Konsequens mit dem Antezendens in Widerspruch steht. Hier also folgt die Konsequenz<br />
»notwendig« aus der Voraussetzung, wie z.B. ‚Wenn es Tag ist, ist Licht da‘. Hingegen sind<br />
nach unserem Modell solche Implik<strong>at</strong>ionen wie, wenn Gras blau ist, dann ist der Mond größer als die<br />
Sonne‘ durchaus wahr, obwohl <strong>bei</strong>de Teilsätze falsch sind und nichts miteinander zu tun haben.<br />
Auf Basis des Folgeverhältnisses und hypothetischen S<strong>at</strong>zes h<strong>at</strong> Chrysipp 5 unbeweisbare, logisch<br />
wahre Argumentformen entdeckt und formalisiert (die sog. anapodeiktoi logoi), auf die alle<br />
komplexeren Schlüsse zrückführbar seien. Er h<strong>at</strong> insofern als erster formale Aussagenlogik (im<br />
Unterschied zur aristotelischen Begriffssyllogistik) betrieben. Die 5 Argumente lauten:<br />
(1) Wenn das 1., dann das 2. Nun aber das 1., also das 2.<br />
(2) Wenn das 1., dann das 2.. Nun aber nicht das 2., also nicht das 1.<br />
(3) Nicht: das 1. und das 2. Nun aber das 1., also nicht das 2.<br />
(4) Entweder das 1. oder das 2. Nun aber das 1., also nicht das 2.