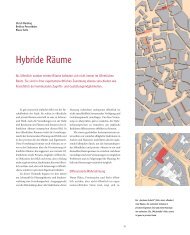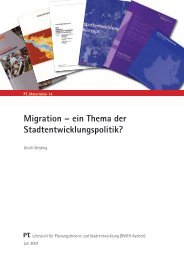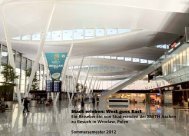Die zeitgerechte Stadt für Familien - Lehrstuhl für Planungstheorie ...
Die zeitgerechte Stadt für Familien - Lehrstuhl für Planungstheorie ...
Die zeitgerechte Stadt für Familien - Lehrstuhl für Planungstheorie ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gesamtauswertung<br />
Räumliche Organisation<br />
Mobilität<br />
+<br />
Hobby Kind<br />
hohe Mobilität<br />
viele, zum Teil weite, Wege im <strong>Familien</strong>alltag bedingen<br />
Stress im <strong>Familien</strong>alltag<br />
viele aufzusuchende räumliche Bezugsorte:<br />
Optimierung in Wegeketten mit möglichst vielen<br />
räuml. Bezugsorten<br />
Wege häufig als belastend empfunden<br />
Zeitdruck räuml. Bezugsorte innerhalb Wegekette<br />
rechtzeitig zu erreichen<br />
hohe Begleitmobilität<br />
von <strong>Familien</strong> nicht als Ursache <strong>für</strong> Zeitkonflikte<br />
erkannt<br />
Ø 39% der Wege der Eltern aufgrund von Begleitmobilität<br />
Ø 81% der Wege der Grundschüler in Begleitmobilität<br />
Begleitmobilität vor allem zu Hobbys<br />
Gründe <strong>für</strong> Begleitmobilität u.a. hohes Verkehrsaufkommen<br />
- Angst der Eltern, gesellschaftlicher<br />
Druck Kinder dem Verkehr nicht alleine auszusetzen<br />
<strong>Die</strong> Mobilitätsmuster der untersuchten <strong>Familien</strong> zeigen eine hohe<br />
und teilweise auch weiträumige Mobilität, besonders der Eltern,<br />
in der <strong>Stadt</strong>, welche im <strong>Familien</strong>alltag häufig Stress bedingt. Dabei<br />
ist die Mobilität in der Regel in Wegeketten mit möglichst vielen<br />
räumlichen Bezugsorten optimiert. Im Durchschnitt organisieren<br />
die Eltern der befragten <strong>Familien</strong> 12,5 räumliche Bezugsorte am<br />
Tag in 3,8 Wegeketten. Dabei legt jedes Elternteil im Durchschnitt<br />
1,9 Wegeketten, in welchen 6,3 räumliche Bezugsorte aufgesucht<br />
werden, zurück (siehe Anhang A Tabelle 1).<br />
Innerhalb von Wegeketten kommt es häufig zu Zeitdruck um<br />
räumliche Bezugsorte rechtzeitig zu erreichen. <strong>Die</strong>s wird im Abschnitt<br />
Zeitliche Organisation, Zeitmuster und Takt auf Seite 105<br />
näher erläutert.<br />
Begleitmobilität<br />
Einer der Gründe <strong>für</strong> die vielen nötigen Wegeketten und das Aufsuchen<br />
dieser großen Anzahl an räumlichen Bezugsorten ist die<br />
Begleitmobilität:<br />
<strong>Die</strong> Untersuchung der räumlichen Bezugsorte und Mobilitätsmuster<br />
der Aachener <strong>Familien</strong> ergibt, dass das Aufsuchen von ca.<br />
1/3 der räumlichen Bezugsorte im Alltag der Eltern aufgrund von<br />
Begleitmobiliät stattfindet. Außerdem werden im Durchschnitt<br />
39% der Wege der Eltern aus Gründen der Begleitmobilität zurückgelegt<br />
(siehe Anhang A Tabelle 2).<br />
<strong>Die</strong> Analyse der Begleitmobilität der Kinder nach Altersgruppe<br />
ergab, dass die Wege der Kinder im Kleinkind- und Kindergartenalter<br />
zu 100%, die Wege der Grundschulkinder zu 81% und auch<br />
die Wege der beiden Schulkinder (12 und 14 Jahre) auf weiterführenden<br />
Schulen durchschnittlich zu 25% begleitet werden (siehe<br />
Anhang A Tabelle 3).<br />
Es fällt auf, dass sich von den sechs <strong>Familien</strong> mit Kindern im<br />
Grundschulalter überhaupt nur in drei <strong>Familien</strong> diese Grundschulkinder<br />
in selbstständiger Mobilität fortbewegen. Von diesen<br />
drei Kindern werden im Durchschnitt jeweils ca. 60% der Wege<br />
begleitet zurückgelegt.<br />
<strong>Die</strong> Analyse der Mobilitätsmuster zeigt, dass am häufigsten Wege<br />
zur Schule in selbstständiger Mobilität zurückgelegt werden,<br />
wobei vor allem die Nähe der Wohnung zur Schule relevant ist<br />
(I1,2,3) oder aber ein zentraler Ausgangspunkt in der Nähe der<br />
Schule, von welcher aus sich das KInd alleine weiter bewegt (I4).<br />
<strong>Die</strong> Wege zu Hobbys von Grundschulkindern werden in allen analysierten<br />
Fällen begleitet.<br />
Auffällig ist, dass die Begleitmobilität in keiner der <strong>Familien</strong> als<br />
Ursache <strong>für</strong> Zeitkonflikte im Alltag erkannt und genannt wurde.<br />
Begleitmobilität wird in den <strong>Familien</strong> größtenteils als unumgängliche<br />
Notwendigkeit angesehen, die nicht hinterfragt wird.<br />
Für Begleitmobilität ließen sich (neben dem zu geringen Alter von<br />
Klein- und Kindergartenkindern <strong>für</strong> selbstständige Mobilität) gesellschaftliche,<br />
infrastrukturelle sowie private Gründe ermitteln:<br />
- gesellschaftlicher Druck Kinder dem hohen Verkehrsaufkommen<br />
nicht alleine auszusetzen (I4,5)<br />
- fehlende Selbstständigkeit der Kinder <strong>für</strong> die mit Umstiegen verbundene<br />
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (I1,2,3)<br />
- Wunsch der Kinder nicht alleine gehen zu müssen (I2)<br />
- um Zeit im Alltag Zeit mit den Kindern zu verbringen (I5)<br />
- Angst vor Verkehrssituation und Kriminalität (I6)<br />
Somit stellt Begleitmobilität in den meisten Fällen Zwangsmobilität<br />
der Eltern dar.<br />
l 104