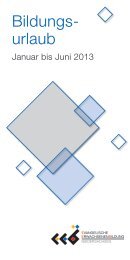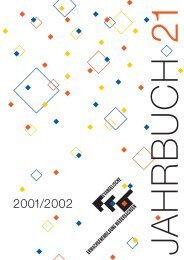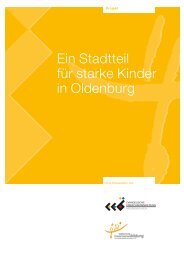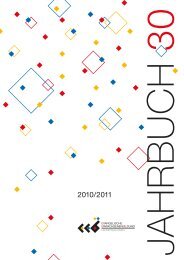Eeb jahrbuch 08 09 v03:layout 1 - EEB Niedersachsen
Eeb jahrbuch 08 09 v03:layout 1 - EEB Niedersachsen
Eeb jahrbuch 08 09 v03:layout 1 - EEB Niedersachsen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
12<br />
rungen durch Erfahrung und die lassen sich durch Bildungsprozesse<br />
nicht einfach herbeiführen. Es gibt hier, wie<br />
LACHMANN sagt, eine relative Konvergenz zur theologischen<br />
Unverfügbarkeit. 7 Der einzelne Mensch bleibt Subjekt<br />
seines Glaubens und lässt sich hier nicht konditionieren<br />
oder determinieren durch bestimmte Faktoren.<br />
HARTMUT VON HENTIG 8 spricht deshalb von einer Mathetik,<br />
also der „Kunst des wirksamen Lernens“ und nicht<br />
von einer Didaktik als Kunst des wirksamen Lehrens. Und<br />
er sagt: „Mit dem Glauben lernen ist es wie mit dem Denken<br />
lernen: man glaubt und denkt schon immer, bevor man<br />
es zu ‚lernen‘ beginnt.“ Seine Konsequenz: Wo kein (bewusster)<br />
Glaube ist, wird Belehrung nichts nützen. Da muss<br />
der Weg der Mathetik, – der Anlässe, Gelegenheiten, Herausforderungen<br />
und des geduldigen Abwartens – besonders<br />
strikt eingehalten werden.“<br />
3. Die beiden hermeneutischen Paradigmen<br />
Diese Differenzierung zwischen Belehrung und Entdeckenlassen<br />
führt uns mitten in eine fundamentale Auseinandersetzung<br />
in der Gemeindepädagogik, die KARL FOITZIK<br />
prägnant mit den Begriffen Hermeneutik der Vermittlung oder<br />
der Verständigung beschrieben hat. Eine Hermeneutik der<br />
Vermittlung will Glauben vorrangig „weitergeben“, eine Hermeneutik<br />
der Verständigung will helfen, den eigenen Glauben<br />
zu klären.<br />
Aus diesen beiden Typen von Hermeneutik und entsprechender<br />
Didaktik haben sich zwei unterschiedliche Zugangsweisen<br />
zu Glauben entwickelt, die mit „Glaube als Option“<br />
und mit „Glaube als Heimat“ bezeichnet werden können.<br />
9 Ich will diese beiden Typen hier kurz skizzieren und<br />
vorab betonen, dass es hier um Typologien geht, die in der<br />
Wirklichkeit immer nicht so lupenrein existieren, sondern in<br />
Mischformen.<br />
Die erste Position „Glaube als Option“ geht von der pluralen<br />
Optionsgesellschaft aus. Sie nimmt wahr, dass Menschen<br />
an übergreifenden Metaerzählungen und großen<br />
Transzendenzen kaum interessiert sind. 10 Sie fragen vielmehr<br />
nach dem individuellen Sinn des Lebens, wollen sich selbst<br />
finden und suchen nach der eigenen Identität. Subjektives<br />
Aneignen und neues Verstehen der Tradition stehen im Zentrum.<br />
Dazu wird Wissen über die christliche Tradition nicht<br />
einfach übernommen, sondern es soll erfahrungsbezogen<br />
erschlossen werden. Entsprechend wird nicht nach Glaubensunterweisung<br />
gefragt, sondern nach religiöser Erlebnisintensität<br />
und Spiritualität. Inhalte müssen zwar kognitiv<br />
stimmig, zugleich aber in einer ästhetischen Atmosphäre,<br />
unter Betonung von Feier und Lebendigkeit dargeboten werden.<br />
Aus der eigenen Lebensgeschichte soll der Glauben<br />
plausibel werden.<br />
Glaubenskurse, die diesem Anspruch folgen, arbeiten<br />
subjektorientiert und kommen häufig aus der Erwachsenenbildung.<br />
Ihr Ziel ist es, Menschen in der Auseinandersetzung<br />
mit unterschiedlichen Positionen zur Klärung ihrer<br />
eigenen Glaubensidentität zu ermutigen und diese Klärung<br />
zu fördern. Dabei werden weniger inhaltliche Vorgaben zu<br />
dem gemacht, was es heute heißt, als Christ zu leben, und<br />
mehr Raum für eigene Antworten und Entdeckungen eröffnet.<br />
Diese Kurse arbeiten stark prozessorientiert. Das Ziel<br />
ist, im Austausch mit anderen eigene Glaubenswege zu finden.<br />
Dabei liegt eine Hermeneutik der Verständigung zugrunde.<br />
Hier gibt es keine eindeutigen, verallgemeinerba-<br />
ren Einsichten, sondern sehr persönliche Erkenntnisse zu<br />
Gottes Wirken in der Welt und im eigenen Leben. Diese Kurse<br />
wollen nicht primär überzeugen, sondern klären helfen<br />
und „Glauben im Leben neu entdecken“.<br />
In der zweiten Position „Glaube als Heimat“ wird Pluralität<br />
vor allem als Grenzenlosigkeit wahrgenommen. Auf<br />
die menschliche Sehnsucht nach Sinn wird mit dem Angebot<br />
von Orientierung, Gewissheit und Heimat reagiert. 11 Unter<br />
diesen Gegebenheiten bevorzugen Glaubenskurse eine<br />
einheitliche und eindeutige christliche Botschaft. Folglich<br />
geht es im Glauben vor allem um eine vertrauensorientierte<br />
Zuwendung (fiducia) und den Glaubensakt. Traditionen<br />
und Gemeinschaft bieten dann eine Plausibilitätsstruktur, die<br />
in der Optionsgesellschaft Halt gibt. 12<br />
Die Leitung des Glaubenskurses wird in diesem Falle<br />
eher zu direktiven Darstellungsweisen tendieren. Christliche<br />
Tradition wird präsentiert und weniger diskutiert, die Teilnehmer<br />
sind vor allem Zuhörende und Aufnehmende. Die<br />
exponierte Stellung der Umkehrliturgien in diesen Kursen<br />
lässt sich in der Weise interpretieren, dass versucht werden<br />
soll, den Glauben „anzuschieben“, obwohl man sich<br />
der Unverfügbarkeit bewusst ist. Die Hermeneutik der Vermittlung<br />
erhält folglich ein stärkeres Gewicht; die Kurse wollen<br />
bezeugen und Glauben weitergeben. Gleichzeitig wird<br />
durch informelle Lernprozesse, zum Beispiel intensive Gespräche<br />
in Gruppen oder auch gemeinsam erlebte liturgische<br />
Handlungen, die emotionale und gemeinschaftsorientierte<br />
Glaubensdimension gefördert.<br />
Kurse dieser Art, die meist in Kirchengemeinden stattfinden,<br />
sind relativ weit verbreitet. Das kann vielleicht damit<br />
erklärt werden, dass sie der Sehnsucht nach Beziehung und<br />
Zuwendung intensiver entsprechen.<br />
Wenn man sich die Sprache des EKD-Papiers „Kirche der<br />
Freiheit“ zur Bildung vor Augen führt, scheint sie auch eher in<br />
diesem Modell „beheimatet“ zu sein. Das erklärt die Irritationen<br />
in der <strong>EEB</strong> über dieses Papier und sein Bildungsverständnis.<br />
In einem gemeinsamen Projekt von Amt für Gemeindedienst<br />
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern<br />
(ELKB) und Evangelischer Fachhochschule unter Leitung<br />
von FRIEDRICH RÖSSNER und mir haben wir fast 50 derzeit<br />
auf dem Markt befindliche Glaubenskurse analysiert und<br />
kategorisiert. Die Ergebnisse wurden im Januar 20<strong>08</strong> über<br />
eine „Glaubenskurs-Finder-CD“ allen Pfarrämter in der<br />
ELKB zugänglich gemacht. 13<br />
Unsere Untersuchung spiegelt exakt diese beiden Modelle;<br />
das vorhandene Kursmaterial verteilt sich ungefähr<br />
50:50 auf diese beiden Typen.<br />
Natürlich liegt es jetzt nahe zu fragen, welches Modell<br />
theologisch und pädagogisch angemessener ist. Eine salomonische<br />
Lösung könnte darin liegen, dass verschiedene<br />
Menschen verschiedene Formen brauchen, wie ja auch<br />
Glaubens- und Lernwege durchaus unterschiedlich sind. In<br />
der Erwachsenenbildung hat sich trotzdem das Modell einer<br />
Hermeneutik der Verständigung durchgesetzt, weil es<br />
die Pluralität unserer Gesellschaft bejaht und der Subjektorientierung<br />
evangelischer Bildung entspricht, aber auch Erkenntnisse<br />
aus der Lernforschung aufnimmt und pädagogisch<br />
anschlussfähig ist. Die neue Öffnung für Methoden<br />
der Erwachsenenbildung z. B. im Kurs „Emmaus“ 14 und die<br />
Bevorzugung von gesprächsorientierten Kleingruppen statt<br />
vorrangiger Plenumspräsentation in anderen Kursen zeigen,<br />
dass hier auch im Bereich der missionarischen Kurse ein