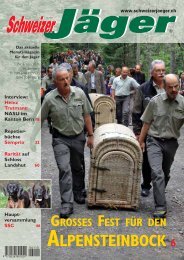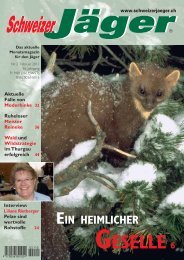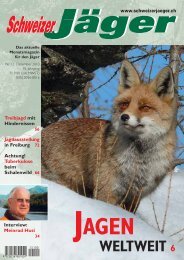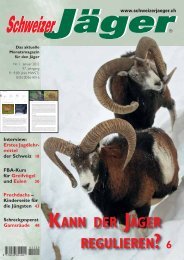Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Tierarzt<br />
Foto: naturpix.ch/ch.meier<br />
Wo reife Böcke fehlen, fallen der Räude gehäuft junge, im Bild ein<br />
Vierjähriger, auch gut konditionierte Böcke zum Opfer.<br />
res Äsungsangebot auch zu einer<br />
besseren Konditionierung<br />
der Gams führe, erwähnen sie<br />
ebenso, wie zusätzlich die Tatsache,<br />
dass trotz allem noch<br />
keine wirksame Massnahme<br />
gefunden werden konnte, die<br />
das Einschleppen der Krankheit<br />
aus verseuchten in bisher<br />
seuchenfreie Gebiete verhindern<br />
könne.<br />
Vorbeugen ist besser als<br />
heilen.<br />
Diesem Grundsatz misst<br />
auch die Biologin Schaschl<br />
in ihrem Buch «Gamsräude»<br />
hohe Bedeutung zu und räumt<br />
wie die zuvor erwähnten Autoren<br />
der Wilddichte, dem Geschlechterverhältnis<br />
und der<br />
Sozialstruktur von Gamspopulationen<br />
hohe Priorität ein.<br />
Auch sie vertritt die Auffassung,<br />
dass die Anzahl Tiere<br />
in einem bestimmten Lebensraum<br />
stets dem dort vorhandenen<br />
Äsungsangebot angepasst<br />
werden müsse. Wobei sie weiter<br />
festhält, dass ein tragbarer<br />
Wildbestand auch unter optimalen<br />
Lebensbedingungen<br />
stets an eine Obergrenze stosse,<br />
deren Überschreitung zum<br />
Kümmern des Wildes und zu<br />
einer Absenkung der Widerstandskraft<br />
gegenüber Erkrankungen<br />
führe.<br />
Sie ist sich auch bewusst,<br />
dass diese Grenzwerte für die<br />
tragbare Wilddichte gebiets-<br />
und äsungsabhängig gros sen<br />
Schwankungen unterliegen<br />
und daher keine Allgemeingültigkeit<br />
besitzen. Als Annäherungswert<br />
erwähnt sie aber<br />
5 bis 8 Gams pro 100 Hektar<br />
als angemessen.<br />
62 <strong>Schweizer</strong> <strong>Jäger</strong> 4/2012<br />
Wie ausschlaggebend die<br />
Wilddichte aber im Zusammenhang<br />
mit einem Seuchengeschehen<br />
wirklich ist, belegt<br />
sie mit dem Hinweis, dass<br />
Seuchen nur in überhöhten<br />
Wildbeständen auftreten, und<br />
dass beim Abklingen einer<br />
Räude-Epidemie die Dichte<br />
von Gamspopulationen noch<br />
1 bis 1,3 Stück pro 100 Hektar<br />
ausmache.<br />
Hohe Priorität besitzt im<br />
Fall der Räude nebst der vorhandenen<br />
Wilddichte auch ein<br />
der Art entsprechendes Geschlechterverhältnis<br />
von 1:1.<br />
Denn nur dadurch lässt sich<br />
eine Abkürzung der Brunft<br />
und damit eine Schonung der<br />
zu diesem Zeitpunkt stark geforderten<br />
Böcke erreichen.<br />
Schaschl erachtet aber ein GV<br />
von 1:1,2 bzw. 1:1,3 noch als<br />
tragbar.<br />
Die Sozialstruktur einer<br />
Gamspopulation sieht sie<br />
dann im Lot, wenn sich diese<br />
am Ende der Schusszeit noch<br />
wie folgt zusammensetzt: Anteil<br />
Tiere der Jugendklasse 45<br />
Prozent und Anteil Vertreter<br />
der Mittel- und Altersklasse<br />
55 Prozent. Wenn der Gamsjäger<br />
diesen Forderungen durch<br />
die Art seiner Jagdausübung<br />
gerecht wird, dann verfügen<br />
die Einzelgams nach Meinung<br />
Schaschls nicht nur über eine<br />
bessere Kondition, sondern<br />
auch über genügend Abwehrkräfte<br />
gegen Krankheiten.<br />
Den Massnahmen zur Räudeabwehr<br />
räumt auch Gressmann<br />
in seiner 2001 an der<br />
Universität Graz verfassten<br />
Dissertation zur Thematik<br />
von «Gamsräude und Gams-<br />
Wo sie in genügender Zahl vorhanden, darf der eine und andere auch erlegt<br />
werden.<br />
blindheit im Gebiet der Steiermark»<br />
viel Platz ein. Übereinstimmend<br />
mit den bisher<br />
genutzten Quellen stehen auch<br />
in seiner Arbeit bezüglich der<br />
Räudevermeidung die Wilddichte,<br />
das Geschlechterverhältnis<br />
und der Altersklassenaufbau<br />
von Gamspopulationen<br />
im Zentrum der Betrachtung.<br />
Mit Hinweis auf die Forschungsergebnisse<br />
von BOCH<br />
u. SCHNEIDAWIND, 1988, KNAUS<br />
u. SCHRÖDER, 1975, PENCE et.<br />
al., 1983, ROSSI et al. 1995,<br />
vertritt auch er die Meinung,<br />
dass sich in vielen Gebieten<br />
(der Steiermark. Verf.) die<br />
Wilddichten an der Obergrenze<br />
der Lebensraumkapazität<br />
oder sogar darüber bewegen.<br />
Schon KNAUS u. SCHRÖDER verwiesen<br />
auf die Tatsache, dass<br />
hohe Gamsbestände nur dann<br />
auf die Dauer gesund erhalten<br />
werden können, wenn durch<br />
eine wirksame Bestandesreduktion<br />
die Lebensbedingungen<br />
für das einzelne Individuum<br />
verbessert werden können.<br />
Ein Ziel, das nur dann erreicht<br />
werden kann, wenn die<br />
Bemühungen nicht an der Reviergrenze<br />
– für die Schweiz<br />
müsste es wohl eher Kantons-<br />
und damit Systemgrenze heissen<br />
– Halt machen. Gressmann<br />
gibt allerdings zu bedenken,<br />
dass zur Dichtebestimmung<br />
aber nicht die Fläche einer<br />
Hegegemeinschaft oder eines<br />
Jagdreviers, sondern nur die<br />
der durch das Gamswild wirklich<br />
genutzten Lebensräume<br />
beigezogen werden dürfe. Wobei<br />
zudem die Unterschiede<br />
zwischen Sommer- und Winterlebensräumen<br />
zu berück-<br />
Foto: naturpix.ch/m.p.stähli<br />
sichtigen wären. Eine Reduktion<br />
der Wilddichten kann<br />
aber nur dann zum Ziel führen,<br />
wenn auch in anzahlmässig<br />
kleinern Populationen deren<br />
Struktur der Biologie der<br />
Art entspricht.<br />
Wie schon NERL 1981 mit<br />
Nachdruck festhält, bringt<br />
daher ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis<br />
von nahezu<br />
1:1 im Zusammenhang<br />
mit dem Räudegeschehen dadurch<br />
Vorteile, dass die Brunft<br />
rasch verläuft und die Böcke<br />
dadurch eher geschont werden.<br />
Ganz abgesehen davon,<br />
dass die Brunft selbst ein hohes<br />
Ansteckungspotenzial in<br />
sich birgt. Sei es durch die<br />
Schwächung der Böcke oder<br />
den engen Kontakt der Tiere<br />
untereinander. Diesen Gefahren<br />
kann dann vorgebeugt<br />
werden, wenn eine genügend<br />
grosse Anzahl reifer Böcke zur<br />
Bildung kleinerer Brunftrudel<br />
führt. Denn nur so wird auch<br />
der Deckerfolg erhöht und die<br />
Brunft nicht dadurch unnötig<br />
verlängert, dass nicht beschlagene<br />
Geissen erneut zyklisch<br />
werden.<br />
Ganz abgesehen davon,<br />
dass sich in kleinern Rudeln<br />
weniger Tiere gegenseitig infizieren,<br />
und die Milben durch<br />
das Verbleiben der Platzböcke<br />
bei diesen Rudeln auch<br />
weniger in andere weiterverschleppt<br />
werden.<br />
Gamswild bleibt auch dann<br />
gesund, wenn nebst dem ausgewogenen<br />
Geschlechterver-<br />
hältnis der Altersklassenaufbau<br />
in den einzelnen Populationen<br />
den natürlichen Gegebenheiten<br />
der Art entspricht.