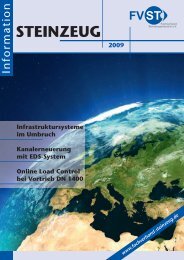STEINZEUG Information 2004 - Fachverband Steinzeugindustrie eV
STEINZEUG Information 2004 - Fachverband Steinzeugindustrie eV
STEINZEUG Information 2004 - Fachverband Steinzeugindustrie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
■ Nennweiten der Vortriebsrohre anteilig an der Gesamtleistung seit 1984.<br />
sich von Beginn an im Wettbewerb gegen die offene Bauweise durchsetzen.<br />
Somit waren Ingenieure und Techniker der Auftraggeber- und Auftragnehmerseite<br />
sowie die Maschinenhersteller ständig gefordert, innovativ tätig<br />
zu sein, um die Vortriebstechnik weiterzuentwickeln, die Anwendungsgebiete<br />
zu erweitern und durch geeignete Maßnahmen ständig die Produktivität<br />
zu steigern, damit sich die geschlossene Bauweise in Konkurrenz zur<br />
offenen Bauweise behaupten konnte. Hier waren es insbesondere mittelständische<br />
Tiefbauunternehmen, die ihre Baustellenerfahrungen innovativ<br />
in die Verbesserung der Maschinentechnik einbrachten.<br />
Die „Berliner Bauweise“, das sternförmige Heranführen der Anschlusskanäle<br />
an Start-, Ziel- und Hilfsschächte in geschlossener Bauweise, schon bei der<br />
ersten Baumaßnahme 1984 von den Berliner Wasserbetrieben konzipiert<br />
und mit der Entwicklung gesteuerter Hausanschlussmaschinen eingeführt,<br />
brachte am Markt den endgültigen wirtschaftlichen Durchbruch der<br />
geschlossenen Bauweise [4], [5].<br />
Die Entwicklung setzte sich sprunghaft fort. Mit dem 1987 bei einer Baumaßnahme<br />
in Berlin-Steglitz erstmals erprobten „pipe-eating“ konnten<br />
nun auch schadhafte Abwasserkanäle unterirdisch erneuert werden. Neben<br />
den Maschinen mit Schneckenförderung wurden von der Fa. Herrenknecht<br />
hydraulisch fördernde Maschinen für kleine Nennweiten entwickelt. Die<br />
Firma Bohrtec brachte 1987 eine Hausanschlussmaschine auf den Markt,<br />
die erstmalig einen ferngesteuerten unterirdischen Anschluss an vorhandene<br />
Abwassersammler ermöglichte [7], [9], [12].<br />
1996 gelang ein weiterer wirtschaftlicher Durchbruch in der Geschichte des<br />
Mikrotunnelbaus. Konnten mit der bisher vorhandenen Technik nur Straßenkanäle<br />
mit der kleinsten Nennweite 250 mm aufgefahren werden, so ermöglichte<br />
eine Entwicklung der Fa. Bohrtec, die BM 300, auch das haltungsweise<br />
Auffahren von Straßenkanälen der Nennweiten 200 mm [15], [16].<br />
Forschung + Technik<br />
Die Berliner Wasserbetriebe haben<br />
mit der nunmehr möglichen Nennweitenreduzierung<br />
von DN 250 auf<br />
DN 200 in den letzten 8 Jahren rd.<br />
12 Mio. Euro an Baukosten eingespart,<br />
die für die Beauftragung<br />
anderer Bauvorhaben verwendet<br />
werden konnten.<br />
Die Entwicklung machte auch vor<br />
dem so genannten „begehbaren“<br />
Nennweitenbereich nicht Halt. Mit<br />
der Technik des Mikrotunnelbaus<br />
wurden in Berlin bisher Rohrquerschnitte<br />
bis zur Dimension DN<br />
3000 unbemannt aufgefahren. In<br />
Kürze erfolgt die Unterquerung des<br />
Westhafenkanals mit Stahlbeton-<br />
Vortriebsrohren der Nennweite DN<br />
3000 im Verfahren des unbemannten<br />
Rohrvortriebs. Insgesamt wurden<br />
in Berlin seit 1984 583 km<br />
Sammel- und Hausanschlusskanäle<br />
im Mikrotunnelbau hergestellt.<br />
Alle diese Entwicklungen sind auch<br />
mit Namen verknüpft: Von der Maschinenherstellerseite<br />
sind es deutsche<br />
Unternehmen wie die Dr.-Ing.<br />
Soltau GmbH, die Herrenknecht<br />
AG oder die Bohrtec GmbH; von<br />
<strong>STEINZEUG</strong>-<strong>Information</strong> <strong>2004</strong><br />
39