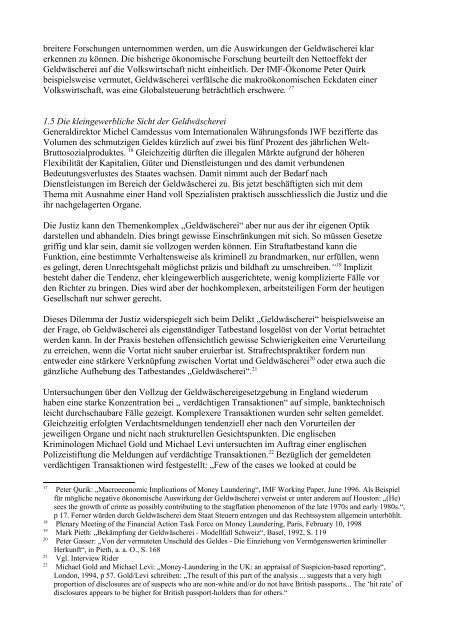Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp
Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp
Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
eitere Forschungen unternommen werden, um die Auswirkungen der <strong>Geldwäscherei</strong> klar<br />
erkennen zu können. Die bisherige ökonomische Forschung beurteilt den Nettoeffekt der<br />
<strong>Geldwäscherei</strong> auf die Volkswirtschaft nicht einheitlich. Der IMF-Ökonome Peter Quirk<br />
beispielsweise vermutet, <strong>Geldwäscherei</strong> verfälsche die makroökonomischen Eckdaten einer<br />
Volkswirtschaft, was eine Globalsteuerung beträchtlich erschwere. 17<br />
1.5 Die kleingewerbliche Sicht der <strong>Geldwäscherei</strong><br />
Generaldirektor Michel Camdessus vom Internationalen Währungsfonds IWF bezifferte das<br />
Volumen des schmutzigen Geldes kürzlich auf zwei bis fünf Prozent des jährlichen Welt-<br />
Bruttosozialproduktes. 18 Gleichzeitig dürften die illegalen Märkte aufgr<strong>und</strong> der höheren<br />
Flexibilität der Kapitalien, Güter <strong>und</strong> Dienstleistungen <strong>und</strong> des da<strong>mit</strong> verb<strong>und</strong>enen<br />
Bedeutungsverlustes des Staates wachsen. Da<strong>mit</strong> nimmt auch der Bedarf nach<br />
Dienstleistungen im Bereich der <strong>Geldwäscherei</strong> zu. Bis jetzt beschäftigten sich <strong>mit</strong> dem<br />
Thema <strong>mit</strong> Ausnahme einer Hand voll Spezialisten praktisch ausschliesslich die Justiz <strong>und</strong> die<br />
ihr nachgelagerten Organe.<br />
Die Justiz kann den Themenkomplex „<strong>Geldwäscherei</strong>“ aber nur aus der ihr eigenen Optik<br />
darstellen <strong>und</strong> abhandeln. Dies bringt gewisse Einschränkungen <strong>mit</strong> sich. So müssen Gesetze<br />
griffig <strong>und</strong> klar sein, da<strong>mit</strong> sie vollzogen werden können. Ein Straftatbestand kann die<br />
Funktion, eine bestimmte Verhaltensweise als kriminell zu brandmarken, nur erfüllen, wenn<br />
es gelingt, deren Unrechtsgehalt möglichst präzis <strong>und</strong> bildhaft zu umschreiben.“ 19 Implizit<br />
besteht daher die Tendenz, eher kleingewerblich ausgerichtete, wenig komplizierte Fälle vor<br />
den Richter zu bringen. Dies wird aber der hochkomplexen, arbeitsteiligen Form der heutigen<br />
Gesellschaft nur schwer gerecht.<br />
Dieses Dilemma der Justiz widerspiegelt sich beim Delikt „<strong>Geldwäscherei</strong>“ beispielsweise an<br />
der Frage, ob <strong>Geldwäscherei</strong> als eigenständiger Tatbestand losgelöst <strong>von</strong> der Vortat betrachtet<br />
werden kann. In der Praxis bestehen offensichtlich gewisse Schwierigkeiten eine Verurteilung<br />
zu erreichen, wenn die Vortat nicht sauber eruierbar ist. Strafrechtspraktiker fordern nun<br />
entweder eine stärkere Verknüpfung zwischen Vortat <strong>und</strong> <strong>Geldwäscherei</strong> 20 oder etwa auch die<br />
gänzliche Aufhebung des Tatbestandes „<strong>Geldwäscherei</strong>“. 21<br />
Untersuchungen über den Vollzug der <strong>Geldwäscherei</strong>gesetzgebung in England wiederum<br />
haben eine starke Konzentration bei „ verdächtigen Transaktionen“ auf simple, banktechnisch<br />
leicht durchschaubare Fälle gezeigt. Komplexere Transaktionen wurden sehr selten gemeldet.<br />
Gleichzeitig erfolgten Verdachtsmeldungen tendenziell eher nach den Vorurteilen der<br />
jeweiligen Organe <strong>und</strong> nicht nach strukturellen Gesichtspunkten. Die englischen<br />
Kriminologen Michael Gold <strong>und</strong> Michael Levi untersuchten im Auftrag einer englischen<br />
Polizeistiftung die Meldungen auf verdächtige Transaktionen. 22 Bezüglich der gemeldeten<br />
verdächtigen Transaktionen wird festgestellt: „Few of the cases we looked at could be<br />
17 Peter Qurik: „Macroeconomic Implications of Money La<strong>und</strong>ering“, IMF Working Paper, June 1996. Als Beispiel<br />
für mögliche negative ökonomische Auswirkung der <strong>Geldwäscherei</strong> verweist er unter anderem auf Houston: „(He)<br />
sees the growth of crime as possibly contributing to the stagflation phenomenon of the late 1970s and early 1980s.“,<br />
p 17. Ferner würden durch <strong>Geldwäscherei</strong> dem Staat Steuern entzogen <strong>und</strong> das Rechtssystem allgemein unterhöhlt.<br />
18 Plenary Meeting of the Financial Action Task Force on Money La<strong>und</strong>ering, Paris, February 10, 1998<br />
19 Mark Pieth: „Bekämpfung der <strong>Geldwäscherei</strong> - Modellfall Schweiz“, Basel, 1992, S. 119<br />
20 Peter Gasser: „Von der vermuteten Unschuld des Geldes - Die Einziehung <strong>von</strong> Vermögenswerten krimineller<br />
Herkunft“, in Pieth, a. a. O., S. 168<br />
21 Vgl. Interview Rider<br />
22 Michael Gold and Michael Levi: „Money-La<strong>und</strong>ering in the UK: an appraisal of Suspicion-based reporting“,<br />
London, 1994, p 57. Gold/Levi schreiben: „The result of this part of the analysis ... suggests that a very high<br />
proportion of disclosures are of suspects who are non-white and/or do not have British passports... The ‘hit rate’ of<br />
disclosures appears to be higher for British passport-holders than for others.“