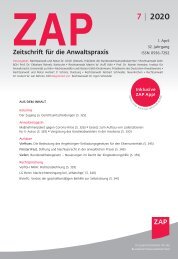ZAP-2018-22
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Straßenverkehrsrecht Fach 9, Seite 1065<br />
Haftungsverteilung<br />
II. Kriterien der Haftungsabwägung<br />
Bei der Haftungsabwägung sind folgende Bemessungsfaktoren zu unterscheiden:<br />
1. Betriebsgefahr<br />
Zu berücksichtigen ist zunächst die Betriebsgefahr der beteiligten Verkehrsteilnehmer, soweit sie einer<br />
Gefährdungshaftung unterliegen (also z.B. nicht Fuhrwerke, Radfahrer). Über den Begriff der Betriebsgefahr<br />
herrscht teilweise in der Kommentarliteratur und in der Rechtsprechung Verwirrung, ohne dass<br />
sich dies allerdings auf das Ergebnis der Haftungsabwägung auswirkt. Teilweise wird unter diesem<br />
Begriff nur die abstrakte Betriebsgefahr des Kraftfahrzeugs verstanden, teilweise diejenige in der<br />
konkreten Situation, teilweise liest man auch, die Betriebsgefahr des Kraftfahrzeugs sei durch die<br />
schuldhaft fehlerhafte Fahrweise des Fahrers erhöht worden. Es sollte wie folgt unterschieden werden:<br />
Allgemeine Betriebsgefahr ist die Gesamtheit der Umstände, welche durch die Eigenart eines<br />
Kraftfahrzeugs für die übrigen Verkehrsteilnehmer die Gefahr einer Schadensverursachung darstellen,<br />
z.B. Fahrzeuggröße, Fahrzeugart, Gewicht, Fahrzeugbeschaffenheit. Ein Pkw hat deshalb im Grundsatz<br />
eine geringere allgemeine Betriebsgefahr als ein Lkw (schwerer lenkbar, längerer Bremsweg, für andere<br />
Verkehrsteilnehmer größeres Sichthindernis).<br />
Besondere Betriebsgefahr ist die Gesamtheit der Umstände, welche in der konkreten Verkehrssituation<br />
zu den obigen Umständen hinzutreten und die Gefahr einer Schadensverursachung erhöhen (BGH NJW<br />
1995, 1029), so dass hierdurch die allgemeine Betriebsgefahr erhöht wird, ohne dass bereits<br />
Verschuldensmomente hinzukommen. Ein Pkw, der auf einem Parkstreifen abgestellt ist, weist keine<br />
besondere Betriebsgefahr auf. Dagegen wird bei einem Pkw, der nach links abbiegt, allein durch diesen<br />
Vorgang die allgemeine Betriebsgefahr erhöht, weil das Linksabbiegen ein komplizierter Vorgang ist<br />
(beachten des rückwärtigen Verkehrs, beachten des Gegenverkehrs, beachten des Fußgängerverkehrs<br />
an der Einmündung, ggf. Abbremsen und Herunterschalten erforderlich, Beachtung der Rückschaupflicht;<br />
vgl. BGH NJW 2005, 1351, 1354). Gleiches gilt z.B. für einen Pkw, der ein anderes Fahrzeug<br />
überholt, aber auch bei einem Verstoß gegen eine Brillenauflage (AG Dortmund SVR <strong>2018</strong>, 260).<br />
Da die besondere Betriebsgefahr situationsbezogen ist, kann diese im konkreten Einzelfall bei einem<br />
Fahrzeug auch höher sein, welches ansonsten eine geringere (allgemeine) Betriebsgefahr aufweist. Ein<br />
Lkw hat im fließenden Verkehr eine größere Betriebsgefahr als ein Pkw; ist der Lkw aber ordnungsgemäß<br />
am Fahrbahnrand abgestellt, geht von ihm eine geringere (besondere) Betriebsgefahr aus als<br />
von einem bei Dunkelheit unbeleuchtet auf einer Schnellstraße abgestellten Pkw.<br />
2. Verschuldensmomente<br />
Verschuldensmomente sind die Umstände, die in der Person des Fahrers liegen und eine zurechenbare und<br />
für den Unfall ursächliche fehlerhafte Fahrweise darstellen. Die Sorgfaltsverletzung muss vorsätzlich oder<br />
fahrlässig erfolgen; der Verschuldensgrad spielt nur bei der Abwägung eine Rolle. Voraussetzung ist daher<br />
grundsätzlich Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit der Schädigung. Es gilt der objektive Fahrlässigkeitsmaßstab<br />
des § 276. Es können nur solche Umstände berücksichtigt werden, die unstreitig oder bewiesen<br />
sind (st. Rspr., vgl. nur BGH NJW 2017, 1177 m.w.N.); insoweit gilt § 286 ZPO und nicht § 287 ZPO (BGH NJW<br />
2007, 506; 2014, 217). Wird eine Mitverantwortlichkeit aufgrund einer Wahlfeststellung bejaht, muss bei der<br />
Abwägung von der weniger belastenden Alternative ausgegangen werden (BGH NJW 1978, 421).<br />
Die gefahrerhöhenden oder verschuldeten Umstände müssen für den Schaden kausal geworden sein.<br />
Dies ist z.B. nicht der Fall bei Fahren ohne Fahrerlaubnis bei korrekt geparktem Kraftfahrzeug (BGH VersR<br />
1962, 374) oder bei Beleuchtungsmängeln im Falle eines Unfalls bei Tageslicht. Ebenso kann die absolute<br />
Fahruntüchtigkeit eines am Unfall beteiligten Kfz-Fahrers infolge Alkoholgenusses bei der Abwägung<br />
nach § 17 StVG nur berücksichtigt werden, wenn feststeht, dass sie sich in dem Unfall niedergeschlagen hat<br />
(BGH NJW 1995, 1029; OLG Hamm NZV 1994, 19; OLG Bamberg VersR 1987, 909; a.A. OLG Celle VersR 1988,<br />
608; OLG Hamm NZV 1990, 393). Gleiches gilt z.B. für eine Übermüdung des Fahrers oder eine überhöhte<br />
Geschwindigkeit. Es ist aber zu beachten, dass solchen Gefährdungen durch Beweiserleichterungen<br />
<strong>ZAP</strong> Nr. <strong>22</strong> 21.11.<strong>2018</strong> 1165