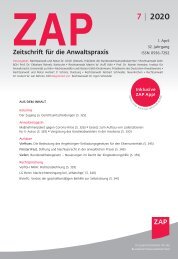ZAP-2018-22
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Straßenverkehrsrecht Fach 9, Seite 1067<br />
Haftungsverteilung<br />
Behaupten z.B. bei einem Kreuzungsunfall beide Pkw-Fahrer, bei Grünlicht gefahren zu sein und lässt sich<br />
die Ampelstellung nicht mehr aufklären, so haften beide Pkw-Fahrer jeweils nur mit ihrer allgemeinen<br />
Betriebsgefahr, nämlich zu je 50 %. War der Unfall für den einen Beteiligten unabwendbar, für den anderen<br />
dagegen nicht, ohne dass ihn ein Verschuldensvorwurf trifft, führt dies sogar zu dessen 100 %iger Haftung<br />
allein aus der Betriebsgefahr des von ihm geführten Fahrzeugs.<br />
Auch wenn die Bestimmung der Quote in jedem Einzelfall neu zu erfolgen hat, lassen sich gleichwohl<br />
gewisse Richtlinien entwickeln:<br />
• Bleibt der Unfallhergang ungeklärt, lässt sich also keinem Beteiligten ein Verschulden nachweisen<br />
und kann auch kein Beteiligter den Unabwendbarkeitsnachweis führen, ergibt sich bei einem Unfall<br />
zwischen zwei Pkw eine Haftungsquote von 50 % zu Lasten jedes Beteiligten, bei einem Unfall<br />
zwischen einem Lkw und einem Pkw dagegen eine Haftungsquote von 60 % zu 40 % zu Lasten des<br />
Lkw. Diese Quoten verschieben sich, wenn einem Unfallbeteiligten eine höhere besondere<br />
Betriebsgefahr anzulasten ist. Wie bei § 254 BGB ist also in erster Linie auf den Verursachungsanteil<br />
abzustellen, während der Verschuldensgrad erst in zweiter Linie in Betracht zu ziehen ist.<br />
• Ist einem Beteiligten ein unfallursächliches fahrlässiges Verschulden vorzuwerfen, während der andere<br />
Verkehrsteilnehmer lediglich den Unabwendbarkeitsnachweis nicht führen kann, wird den letzteren<br />
i.d.R. nur eine Mithaftung in Höhe der allgemeinen Betriebsgefahr von 20 % (Pkw) bis 30 % (Lkw, Bus)<br />
treffen. Auch diese Quote kann sich allerdings bei Vorliegen einer besonderen Betriebsgefahr erhöhen.<br />
• Bei schwerwiegendem Verschulden auf der einen und bloßer Betriebsgefahr auf der anderen Seite kann<br />
der schuldhaft Handelnde allein haften; die Betriebsgefahr tritt zurück (BGH NJW 1998, 1137, 1138; 2017, 1177).<br />
Unter Umständen gilt dies sogar dann, wenn den anderen Teil außer der Betriebsgefahr auch ein leichtes<br />
Verschulden trifft (vgl. BGH VersR 1960, 609; OLG München VersR 1963, 739). Das grobe Mitverschulden<br />
eines erwachsenen Fußgängers oder Radfahrers kann ebenfalls die bloße einfache Betriebsgefahr eines<br />
Kraftfahrzeugs vollständig verdrängen (OLG Köln NZV 2008, 100; KG NZV 2010, 149; OLG Hamm NJW-RR<br />
2016, 1043; OLG Celle NZV 2016, 5<strong>22</strong>). Dagegen führt das grobe Mitverschulden eines geschädigten Kindes<br />
(über 10 Jahre, vgl. § 828 Abs. 2 BGB) nur dann zu einer völligen Freistellung für die Betriebsgefahr, wenn<br />
der Sorgfaltsverstoß auch altersspezifisch besonders vorwerfbar war (BGH NZV 2007, 207).<br />
Ein schweres Verschulden ist insbesondere im Falle grober Fahrlässigkeit anzunehmen. Die grobe<br />
Fahrlässigkeit ist eine Steigerung der leichten Fahrlässigkeit und entspricht dem strafrechtlichen Begriff<br />
der Leichtfertigkeit (BGHZ 106, 204, 211 = NJW 1989, 974). Sie liegt vor, wenn die verkehrserforderliche<br />
Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt wird (s. Legaldefinition in § 45 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 SGB X),<br />
schon einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht angestellt oder beiseite geschoben werden<br />
und das nicht beachtet wird, was im gegebenen Fall sich jedem aufgedrängt hätte (st. Rspr., vgl. nur<br />
BGHZ 10, 14, 16; BGHZ 89, 153, 161; BGH NJW 2007, 2988). Ein Verstoß gegen die Normen der StVO ist zur<br />
Begründung grober Fahrlässigkeit weder erforderlich noch ausreichend. Stets ist im Einzelfall<br />
festzustellen, ob die Normverletzung oder der Verstoß gegen eine sonstige Verhaltenspflicht, der zu<br />
einem Schaden geführt hat, mit einem groben Verschulden einhergeht. Anzunehmen ist dies stets bei<br />
einem Verstoß gegen elementare Verhaltenspflichten, wie z.B. bei den sog. Todsünden im Straßenverkehr<br />
gem. § 315c StGB. Ein Augenblicksversagen ist kein Grund, grobe Fahrlässigkeit zu verneinen,<br />
wenn die objektiven Merkmale der groben Fahrlässigkeit gegeben sind. Denn eine Vielzahl der Fälle<br />
unbewusster Fahrlässigkeit beruht gerade bei Regelverstößen im Straßenverkehr darauf, dass der<br />
Handelnde für eine kurze Zeit unaufmerksam ist und das an ihn gerichtete Gebot oder Verbot<br />
übersieht. Vielmehr müssen nach der Rechtsprechung des BGH weitere, in der Person des Handelnden<br />
liegende besondere Umstände hinzukommen, die den Grund des momentanen Versagens erkennen<br />
und in einem milderen Licht erscheinen lassen, um ein grobes Verschulden verneinen zu können (BGHZ<br />
119, 147, 149; OLG Hamm VersR 1988, 1260; OLG Köln NJW-RR 1991, 480). Soweit die Instanzgerichte<br />
teilweise grobe Fahrlässigkeit bereits deshalb verneinen, weil der Handelnde nur für einen Augenblick<br />
versagt hat (vgl. OLG Hamm VersR 1990, 1230; 1991, <strong>22</strong>3; 1991, 1368; OLG Frankfurt VersR 1992, 230;<br />
OLG Köln VersR 1991, 1266), ist dem vom BGH – unter Aufgabe seiner eigenen Rechtsprechung – eine<br />
Absage erteilt worden (BGHZ 119, 147, 150 = NJW 1992, 2418 im Gegensatz zu BGH NJW 1989, 1354, 1355).<br />
Grobe Fahrlässigkeit ist z.B. zu bejahen bei Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um<br />
<strong>ZAP</strong> Nr. <strong>22</strong> 21.11.<strong>2018</strong> 1167