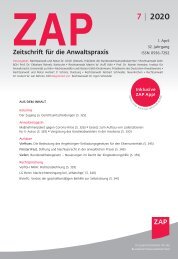ZAP-2018-22
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Verfassungsrecht/Verwaltungsrecht Fach 19 R, Seite 485<br />
Rechtsprechungsübersicht – 1. Hj. <strong>2018</strong><br />
erstellen zu können. Die Auswahl der heranzuziehenden Erkenntnisquellen unterliege dabei grundsätzlich<br />
seiner gerichtlich überprüfbaren Einschätzung. Für den Beurteilungszeitraum wesentliche<br />
Erkenntnisquellen werde er regelmäßig nicht außer Acht lassen können. Jedoch schwinde mit der<br />
Bedeutung, die die einzelne Erkenntnisquelle für den Inhalt der Beurteilung habe, die Notwendigkeit, alle<br />
erdenklichen Erkenntnisquellen in ihrer Vollständigkeit heranzuziehen. Ihre Auswertung sei namentlich<br />
dann entbehrlich, wenn die bereits in Anspruch genommenen, wesentlich gewichtigeren Erkenntnisquellen<br />
eine hinreichend differenzierte Aussage über die dienstliche Tätigkeit des zu beurteilenden<br />
Beamten zuließen.<br />
Hinweis:<br />
Beruht die dienstliche Beurteilung vollständig oder teilweise auf Beurteilungsbeiträgen Dritter, umfasst die<br />
Pflicht zur Plausibilisierung der Beurteilung auch eine Erläuterung, wie aus diesen Beiträgen die in der<br />
dienstlichen Beurteilung enthaltenen Werturteile entwickelt wurden. Abweichungen von den in den Beurteilungsbeiträgen<br />
enthaltenen Tatsachen oder Wertungen sind zu erläutern. Übernimmt der Beurteiler<br />
schlicht einen solchen Beitrag, bedarf es hierfür keiner Begründung (st. Rspr., vgl. BVerwG Buchholz 232.0<br />
§ 21 BBG 2009 Nr. 4 Rn 27 m.w.N.).<br />
Zu der Gewichtung in einer dienstlichen Beurteilung führt das BVerwG aus, es sei Sache des Dienstherrn<br />
festzulegen, welches Gewicht er den einzelnen Merkmalen einer dienstlichen Beurteilung zumessen<br />
wolle. Das abschließende Gesamturteil dürfe sich nicht auf die Bildung des arithmetischen Mittels<br />
aus den einzelnen Leistungsmerkmalen beschränken. Vielmehr komme im Gesamturteil die unterschiedliche<br />
Bedeutung der Einzelbewertungen durch ihre entsprechende Gewichtung zum Ausdruck.<br />
Das abschließende Gesamturteil sei danach durch eine Würdigung, Gewichtung und Abwägung<br />
der einzelnen bestenauswahlbezogenen Gesichtspunkte zu bilden. Diese Gewichtung bedürfe bei<br />
sog. Ankreuzbeurteilungen schon deshalb einer Begründung, weil nur so die Einhaltung gleicher<br />
Maßstäbe gewährleistet und das Gesamturteil nachvollzogen und einer gerichtlichen Überprüfung<br />
zugeführt werden könne. Einer – ggf. kurzen – Begründung bedürfe es insbesondere dann, wenn die<br />
Beurteilungsrichtlinien für die Einzelbewertungen einerseits und für das Gesamturteil andererseits<br />
unterschiedliche Bewertungsskalen vorsähen. Denn hier müsse erläutert werden, wie sich die<br />
unterschiedlichen Bewertungsskalen zueinander verhielten und wie das Gesamturteil aus den Einzelbewertungen<br />
gebildet worden sei. Im Übrigen seien die Anforderungen an die Begründung für das<br />
Gesamturteil umso geringer, je einheitlicher das Leistungsbild bei den Einzelbewertungen sei. Gänzlich<br />
entbehrlich sei eine Begründung für das Gesamturteil jedoch nur dann, wenn im konkreten Fall eine<br />
andere Note nicht in Betracht komme, weil sich die vergebene Note – vergleichbar einer Ermessensreduzierung<br />
auf Null – geradezu aufdränge.<br />
3. Inhaltliche Anforderungen an die Aufforderung, sich einer amtsärztlichen Untersuchung zu<br />
unterziehen<br />
Eine an den Beamten gerichtete Aufforderung, sich einer amtsärztlichen Untersuchung zu unterziehen,<br />
um seine Dienstfähigkeit zu überprüfen, unterliegt aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit<br />
folgenden formellen und inhaltlichen Anforderungen. Diese betreffen die Angabe der Gründe, aus denen<br />
sich die Zweifel an der Dienstfähigkeit des Beamten ergeben, und die Bestimmung von Art und Umfang<br />
der ärztlichen Untersuchung (vgl. BVerwGE 146, 347 Rn 18 ff.). Diese Anforderungen gelten nach dem<br />
Beschluss des BVerwG vom 16.5.<strong>2018</strong> (2 VR 3.18) jedoch nicht absolut, sondern können vom Dienstherrn<br />
nur nach dem ihm vorliegenden Erkenntnisstand erfüllt werden. Habe die Behörde keinerlei weitergehende<br />
Erkenntnisse als die, dass und in welchem Umfang der Beamte krankheitsbedingte Fehltage<br />
aufweise, könne sie auch nur dies als Grund für ihre Zweifel an der dauernden Dienst(un-)fähigkeit des<br />
Beamten anführen; sei den vom Beamten eingereichten ärztlichen Attesten (Arbeitsunfähigkeits-<br />
Bescheinigungen, „Krankschreibungen“) – wie vielfach – kein Grund der gesundheitlichen Beeinträchtigung<br />
zu entnehmen und sei ein solcher Grund von dem Beamten auch nicht anderweitig freiwillig<br />
offenbart oder sonst wie bekannt geworden, könne die Behörde – naturgemäß – auch die Art und den<br />
Umfang der ärztlichen Untersuchung nicht näher eingrenzen.<br />
<strong>ZAP</strong> Nr. <strong>22</strong> 21.11.<strong>2018</strong> 1179