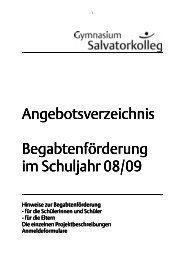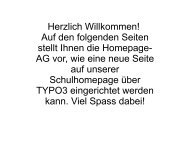Spende - Salvatorkollegs Bad Wurzach
Spende - Salvatorkollegs Bad Wurzach
Spende - Salvatorkollegs Bad Wurzach
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
56 Sprachen<br />
vorhandene Faulheit des Sprechers. er jedoch diese Verwandtschaft, die sich erst Fazit:<br />
Quellen:<br />
57<br />
1<br />
sich eine rekonstruierte Endung der 3. Ps. Sg.<br />
Kleiner sprachwissenschaftlicher Exkurs zum<br />
Thema „Sprachverwandtschaft“<br />
aus der Sicht einer Deutschen<br />
„Diese Sprachen sind ja miteinander verwandt!“<br />
– Mit diesem Satz wird oft begründet,<br />
dass es nicht schwer sei, z.B. mit Kenntnissen<br />
in Französisch auch die spanische<br />
Sprache zu erlernen. Keine schlechte Sache,<br />
aber funktioniert das auch mit anderen Sprachen,<br />
und wenn ja, mit welchen? Könnte man<br />
einem Nicht-Europäer gegenüber das Gleiche<br />
auch über Französisch und Deutsch sagen?<br />
Und wenn wir schon dabei sind: Was genau<br />
ist denn „Sprachverwandtschaft“? Welche<br />
Sprachen sind wirklich miteinander verwandt?<br />
Wie lässt sich diese Grenze „verwandt<br />
– nicht verwandt“ definieren?<br />
Hierzu sei kleiner Exkurs zur Sprachwissenschaft<br />
erlaubt: Es gibt innerhalb der Sprachwissenschaft<br />
bzw. Linguistik verschiedene<br />
Schwerpunkte. Die sogenannte „allgemeine<br />
Sprachwissenschaft“ beschäftigt sich mit<br />
dem Vergleich unterschiedlicher Sprachen<br />
und Sprachfamilien. Sie versucht, zwischen<br />
definitiv nicht-verwandten Sprachen allgemeine<br />
Gesetzmäßigkeiten herauszufinden,<br />
wie z. B. die Sprachökonomie, die allgemein<br />
Die „historisch-vergleichende Sprachwissenschaft“<br />
oder auch „indoeuropäische/indogermanische<br />
Sprachwissenschaft“ indes<br />
untersucht die Gemeinsamkeiten zwischen<br />
definitiv miteinander verwandten Sprachen<br />
und versucht eine gemeinsame Ursprache,<br />
die ca. 4000 v. Chr. gesprochen worden sein<br />
könnte, zu rekonstruieren. Hierfür hat die indoeuropäische<br />
Sprachwissenschaft ganz klar<br />
festgesetzt, nach welchen Kriterien Sprachen<br />
als „miteinander verwandt“, „einer Sprachfamilie<br />
zugehörig“ bezeichnet werden können.<br />
Es gibt zwei Kriterien: Zum einen grammatikalische<br />
Gemeinsamkeiten, das Vorhandensein<br />
mehrerer ähnlicher/vergleichbarer<br />
Phänomene. Ein Beispiel: Sämtliche indoeuropäischen<br />
Sprachen sind „flektierend“ (aber:<br />
nicht alle flektierendenSprachen sind indoeuropäisch),<br />
das heißt, dass die Endung eines<br />
Wortes Aufschluss über dessen Funktion im<br />
Satz und dessen Aussage gibt. In den älteren<br />
Sprachstufen der indoeuropäischen Sprachen<br />
ist die Satzstellung deshalb auch relativ (!)<br />
frei. 2 Im Lateinischen endet beispielsweise die<br />
3. Ps. Sg. stets auf -t. Im Griechischen gibt es<br />
die Endungen (thematisch) -ei, -si, -ti (bei esti<br />
= lat. est.). Zusammen mit der Endung der 3.<br />
Ps. Sg. Präs. Aktiv im Altindischen auf -ti und<br />
dem Befund aus weiteren indoeuropäischen<br />
Sprachen wie dem Althochdeutschen ergibt<br />
Präs. Aktiv auf *-ti.<br />
Das zweite Kriterium ist die Lexik. Hierbei<br />
vergleicht man Wörter, die in verschiedenen<br />
Sprachen eine – nach bestimmten Lautgesetzen<br />
– gleiche oder ähnliche Form aufweisen<br />
und auch semantische (von der Bedeutung<br />
her) Überstimmungen zeigen. Beispiele<br />
hierfür sind: lat. lupus und gri. lykós. Oder lat.<br />
decem, gri. déka, deutsch zehn.<br />
Wie schon angedeutet, hat unser heutiges<br />
Deutsch eine ganze Menge bewahrt:<br />
Kasusendungen finden sich z. B. im Paradigma:<br />
„der Mann – des Mannes – dem Manne –<br />
den Mann“. 3 Oder das Wort „die Geburt“,<br />
althochdeutsch „giburti“ als Abstraktum<br />
auf -ti- zu „gebären“ 4 , was wiederum mit lat.<br />
griech. ferō – „ich trage“ verwandt ist. 5<br />
Natürlich kamen im Laufe der Zeit viele neue<br />
Wörter aus anderen Sprachen zum deutschen<br />
Wortschatz hinzu, man denke an Lehnwörter<br />
wie den „guten Rutsch“ von hebräisch rosch –<br />
„Kopf, Haupt“ (das Hebräische zählt zu den<br />
semitischen Sprachen), oder „Keller“ und<br />
„Zelle“ aus lat. cella, ganz zu schweigen von<br />
den vielen Anglizismen. 6<br />
Kurze Zwischenbilanz:<br />
Man kann also guten Gewissens einem<br />
Nicht-Europäer erklären, dass Französisch<br />
und Deutsch miteinander verwandt sind. Ob<br />
durch Rekonstruktion eines Wortes ins Urgermanische<br />
und Lateinische und von dort aus<br />
weiter in das Indoeuropäische zeigen lässt,<br />
erkennt, ist eine andere Frage. Machbar ist es<br />
in vielen Fällen!<br />
Vielleicht kann man sich die indoeuropäische<br />
Sprachfamilie so am besten veranschaulichen:<br />
Französisch, Spanisch, Italienisch, Rumänisch,<br />
Sardisch, Korsisch und Rätoromanisch sind<br />
allesamt Töchter von Mutter Latein. Latein ist<br />
wiederum Tochter von Uritalisch. Die germanischen<br />
Sprachen wie die „Zwillinge“ Deutsch<br />
und Niederländisch, Englisch, Friesisch und<br />
Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Isländisch<br />
sind Töchter von den Schwestern Westgermanisch<br />
und Nordgermanisch. Deren Mutter<br />
heißt dann Urgermanisch. Urgermanisch und<br />
Uritalisch sind wiederum Schwestern, Töchter<br />
von Indoeuropäisch.<br />
Alle Geschwister haben große Ähnlichkeit mit<br />
der jeweiligen Mutter und auch untereinander<br />
– wie das bei Geschwistern nun mal so<br />
ist; da sie allerdings an verschiedenen Orten<br />
vorkommen, haben sie sich auch unterschiedlich<br />
entwickelt, auch das kennt man<br />
von Geschwistern. Dabei beeinflussen Nachbarn,<br />
geographische Besonderheiten und die<br />
Lebensumstände die Entwicklung der<br />
Sprachen.<br />
Wir haben festgestellt, dass es unterschiedliche<br />
„Verwandtschaftsgrade“ von Sprachen<br />
unter einander gibt und zur Festlegung dieser<br />
Verwandtschaftsgrade bestimmte Kriterien.<br />
Wir haben erfahren, dass unsere Sprache<br />
Neu hochdeutsch mit deutlich mehr Spra -<br />
chen verwandt ist, als uns vielleicht bisher<br />
be wusst war.<br />
Vielleicht wurde auch klar, dass die Annäherung<br />
an das indoeuropäische System<br />
anhand z. B. der Kenntnisse der lateinischen<br />
Grammatik sehr hilfreich beim Erlernen der<br />
indoeuropäischen Sprachen ist, das habe<br />
ich persönlich auch erfahren. Sie hilft – auf<br />
grammatikalischer Ebene – aber auch beim<br />
Erlernen nicht-indoeuropäischer Sprachen, da<br />
man immerhin ein System hat, mit dem man<br />
vergleichen kann. Auf der Ebene des Wortschatzes<br />
ist es ein „alter Trick“ von Vielsprachlern,<br />
dass man umso mehr Eselsbrücken<br />
und Merkhilfen findet, je mehr Vokabeln in<br />
verschiedenen Sprachen (die nicht unbedingt<br />
miteinander verwandt sein müssen) man<br />
beherrscht.<br />
Danke für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß<br />
mit unseren Sprachen!<br />
Susanne Zwilling<br />
LIV= Lexikon der indigermanischen Verben .<br />
Wiesbaden 2001 2 .<br />
Sonderegger, S.: Althochdeutsche Sprache<br />
und Literatur. Berlin-New York 2003 3 .<br />
Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen<br />
Sprache. Berlin – New York 2002 24 .<br />
Weiterführende Literatur (ohne jeglichen<br />
Anspruch auf Vollständigkeit):<br />
A. Stedje: Deutsche Sprache gestern und<br />
heute. Paderborn 2007 6 (utb 1499).<br />
www. indogermanistik.org – offizielle Website<br />
der indogermanischen Gesellschaft mit mehr<br />
Informationen über das Fach.<br />
1) Am einfachsten etwa so zu erklären: „Wozu<br />
komplizierte Formen verwenden, wenn das<br />
Gegenüber auch mit einfacheren Formen<br />
weiß, was gemeint ist?“<br />
2) Anders als das Englische heute, das im<br />
Laufe der Geschichte seine Kasusendungen<br />
bis auf den Genitiv verloren hat.<br />
3) Im Althochdeutschen dekliniert dieses<br />
Wort wie folgt: man – mannes – manne –<br />
man. Pl: man – manno – mannum,<br />
mannom – man. (Sonderegger 266).