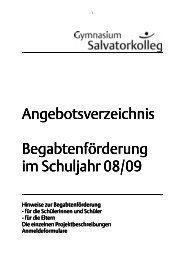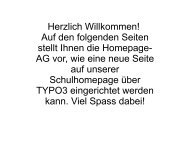Spende - Salvatorkollegs Bad Wurzach
Spende - Salvatorkollegs Bad Wurzach
Spende - Salvatorkollegs Bad Wurzach
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
118 werden können, hält die psychische Abhän- komplexe System der Nervenzellverschaltung Das Aufhören ist nämlich niemals einfach,<br />
119<br />
gigkeit oft ein Leben lang an; unser Gehirn<br />
erinnert sich nämlich in vielen (kritischen)<br />
Lebenslagen an die positiven Effekte einer<br />
Droge. Daher ist es wichtig, das Entstehen<br />
der psychischen Abhängigkeit genauer zu<br />
beleuchten.<br />
Dr. Leibfarth wies explizit darauf hin, dass der<br />
Prozess der Suchtentwicklung ein schleichender<br />
sei. Die Aussage eines Jugendlichen,<br />
„Ich trinke je nach Stimmung, aber ich übertreibe<br />
es nicht”, entlarvt den Mechanismus<br />
des Selbstbetrugs, nämlich zu glauben, man<br />
könne eine Droge beherrschen. Anfänglich<br />
betone der Konsument oft, dass es sein Wille<br />
sei, eine Droge „genussvoll” zu konsumieren.<br />
Sie sei nur von positiver Wirkung, weil sie<br />
schmecke, entspannend wirke und die Stimmung<br />
verbessere. Der Konsum – so glaubt es<br />
zumindest der Konsument – sei ein kontrollierter<br />
und demzufolge sei es ihm jederzeit<br />
möglich, die Droge abzusetzen. Doch das<br />
Problem liegt eigentlich nicht im Aufhören-<br />
Können, sondern im Nicht-Aufhören-Wollen.<br />
Während des Konsums einer Droge lernt das<br />
Gehirn unmerklich, die Gemütsveränderung<br />
zu schätzen. Der Konsument bemerkt also<br />
nicht, wie sich sein Wille verändert; seine<br />
Motivation zum Drogenkonsum wird immer<br />
stärker. Auf neuronaler Ebene verändert sich<br />
im Laufe der Suchtentstehung sowohl das<br />
als auch die Intensität der Nervenzellkommunikation.<br />
Nora Volkow, die Leiterin des Brookhavens<br />
National Laboratory in Pennsylvania, konnte<br />
mit ihren Team dieses Verlangen mit der PET<br />
(Positronen Emmisssions Tomographie) – ein<br />
bildgebendes Verfahren, mit welchem man<br />
dem Gehirn quasi beim Arbeiten zusehen<br />
kann – sichtbar machen. Ihre Probanden (18<br />
Kokainabhängige) zeigten beim Betrachten<br />
von Videos mit neutralen Reizen (Naturaufnahmen)<br />
keine nennenswerte Gehirnaktivität.<br />
Zeigte man ihnen jedoch Filmsequenzen<br />
über den Kauf und Konsum von Kokain, so<br />
wurde v.a. im Belohnungssystem eine hohe<br />
Nervenzellaktivität gemessen, da diese Zellen<br />
das Glückshormon Dopamin ausschütteten;<br />
normalerweise sind diese Gehirnareale u.a.<br />
nur dann aktiv, wenn wir z. B. unser Lieblingsessen<br />
erblicken. Das Forscherteam schloss<br />
daraus, dass die Gier nach Kokain in denselben<br />
Hirnregionen entsteht wie der Ansporn<br />
zur Nahrungsmittelaufnahme. Es liegt also<br />
nahe, dass man die Intensität des lebenserhaltenden<br />
Verlangens nach Nahrung mit dem<br />
des Erwerbs und des Konsums von Drogen<br />
gleichsetzen kann bzw. muss. Gutgemeinte<br />
Ratschläge wie „Hör doch einfach mit dem<br />
Drogenkonsum auf” oder „Du musst nur<br />
einmal damit aufhören” sind kontraproduktiv.<br />
weil man immer darum kämpfen muss, mit<br />
dem Aufhören niemals aufzuhören. Eine<br />
Sucht basiert auf einer erlernten Gehirnaktivitätsänderung<br />
und sei, so Leibfarth,<br />
eine echte Krankheit, deren Heilung nicht<br />
„einfach mal so” erreicht werden könne.<br />
Selbst Personen, welche man medizinisch als<br />
„clean” bezeichnen könne, würden oft durch<br />
suchtspezifische Reize (Orte des Drogenkonsums,<br />
akustische und u.a. optische Reize) in<br />
Versuchung geführt.<br />
Ist die Vorstellung nicht reizvoll, an einem<br />
warmen Sommertag gemütlich im Biergarten<br />
zu sitzen, das angenehme Prickeln des<br />
Bierschaums im Mund und den kühlen Gerstensaft<br />
die Kehle hinunterfließen zu spüren?<br />
Ein kaltes Apfelschorle ist zwar gut, aber die<br />
meisten werden beipflichten, dass ein kaltes<br />
Bier unvergleichlich wohltuender ist - zumal<br />
es oder weil es das Psychostimulans Ethanol<br />
enthält.<br />
Auch „Die fromme Helene” (Wilhelm Busch)<br />
weiß, „wer Sorgen hat, hat auch Likör!”<br />
Gute Vorsätze und die Hinwendung zum<br />
Gebet bringen ihr Suchtgedächtnis und das<br />
daraus resultierende Suchtverlangen nicht<br />
zum Schweigen, denn die Likörflasche ruft<br />
ständig nach der auf dem Betstuhl Knienden.<br />
Schließlich wird der Lockruf zu stark, denn<br />
zu „gefährlich ist des Freundes Nähe. O Lene,<br />
Lene! Wehe, wehe!”<br />
Lene zeigt dem Leser bzw. Betrachter der<br />
Bildergeschichte eindeutige Suchtmerkmale.<br />
Um eine Abhängigkeit diagnostizieren<br />
zu können, müssen in den letzten zwölf<br />
Monaten drei von sechs Kriterien zugetroffen<br />
haben.<br />
1. starker Konsumwunsch<br />
2. abnehmende Kontrollfähigkeit<br />
3. Entzugssymptom(e) bei Nichtverfüg-<br />
barkeit der Droge<br />
4. Toleranzentwicklung (Dosissteigerung)<br />
5. Vernachlässigung anderer Interessens-<br />
gebiete<br />
6. anhaltender Konsum, trotz Wissen um<br />
schädliche Folgen<br />
Dr. Markus Leibfarth<br />
Beim Durchlesen der Abhängigkeitskriterien<br />
kann man zum Schluss kommen, dass die<br />
Entwicklung einer Sucht ein „selbstgemachtes”<br />
Problem sei. So einfach ist die Sachlage<br />
jedoch nicht, denn die Entwicklung einer Abhängigkeit<br />
wird von vielen unterschiedlichen<br />
Faktoren beeinflusst. So kann z. B. unsere<br />
genetische Grundausstattung ein wesentlicher<br />
Baustein sein.<br />
Studien haben ergeben, dass adoptierte<br />
Kinder ein vierfach erhöhtes Risiko zur Suchtentwicklung<br />
haben, wenn ihre Eltern bereits<br />
abhängig waren. Auch Studien des Verwandtenkreises<br />
sowie Zwillingsstudien zeigen<br />
ähnliche Tendenzen. Es ist jedoch reine Provokation<br />
zu behaupten, dass „Nachkommen<br />
von Trunkenbolden auch Trunkenbolde” seien<br />
(Plutarch). Natürlich spielen unsere Gene eine<br />
wichtige Rolle, aber sie sind nicht allesentscheidend<br />
für die Entwicklung einer Abhängigkeit.<br />
Auch die familiären Verhältnisse (das<br />
Gefühl der Sicherheit und des Aufgehobenseins,<br />
das der Gewissheit der Wertschätzung<br />
und des Vertrauens) sowie gesellschaftliche<br />
Einflüsse (Freundeskreis, Milieu, Bildung aber<br />
auch u.a. Einflüsse aus der Werbung) können<br />
wichtige Einflussfaktoren sein.<br />
An einem stark vereinfachten Beispiel wird<br />
dies im Folgenden erklärt werden.<br />
Gene sind Bauanleitungen für Proteine, welche<br />
jeweils in zweifacher Ausführung – eines<br />
wurde von der Mutter und eines vom Vater<br />
vererbt – vorliegen. Trägt eine Bauanleitung<br />
derartige Informationen, dass z. B. eine