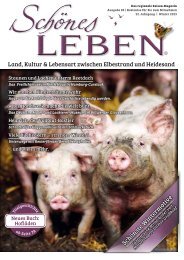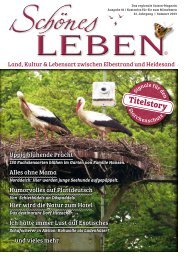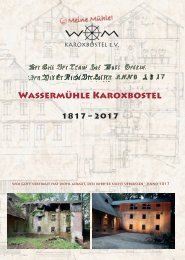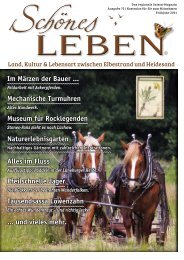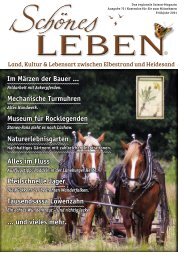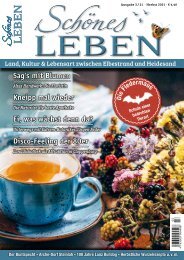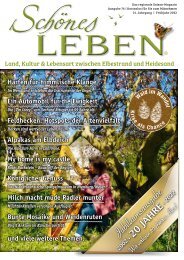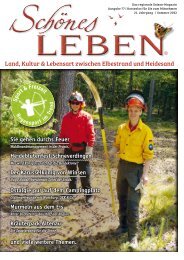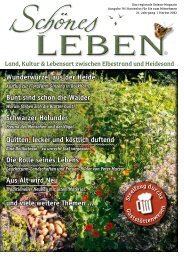SCHÖNES LEBEN – Ausgabe 82
Land, Kultur & Lebensart zwischen Elbestrand und Heidesand
Land, Kultur & Lebensart zwischen Elbestrand und Heidesand
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die historische Aufnahme zeigt die Abbrucharbeiten der<br />
Wohnhäuser am Kehrwiederfleet. Ab dem 16. Jahrhundert<br />
wuchs das Kehrwiederviertel direkt am Stadtwall, heute<br />
Am Sandtorkai, zu einem Arbeiter- und Handwerkerquartier<br />
mit teils enger Gängeviertelbebauung heran.<br />
Für den Bau der Speicherstadt wurden die Bewohner ab<br />
18<strong>82</strong> zwangsumgesiedelt. Das gesamte Wohnviertel wurde<br />
niedergelegt. Foto: Staasarchiv Hamburg<br />
Die historische Aufnahme von der Ecke Stubbenhuk/<br />
Schaartor stammt von einer Reklamemarke, die seinerzeit<br />
für Werbezwecke benutzt wurde.<br />
verfeindete Jugendgangs, blutige Nasen und den Gestank der<br />
Kloake. „Mein Großvater war 1907 geboren worden in einem<br />
der engen Häuser mit Plumsklos auf dem Hof, das sich mehrere<br />
Familien teilten“, berichtet Andreas Karmers. Walter<br />
Wedstedts Mutter betrieb einen Zeitungsladen in der Neustädter<br />
Straße. „Mein Großvater und mein Onkel sind dort<br />
geboren. Damals säumten alte Fachwerkhäuser die Straßen,<br />
die dann den Gründerzeithäusern weichen mussten“, berichtet<br />
der Filmemacher. Der Geschichte seiner Familie, insbesondere<br />
der seines Großvaters als Ich-Erzählerstimme aus<br />
dem Off, stellt Andreas Karmers historische Materialien<br />
gegenüber und zeichnet so den gesellschaftlichen und politischen<br />
Wandel in den Gängevierteln nach.<br />
Die Gängeviertel: Eng mit Fachwerkhäusern<br />
bebaute Wohnquartiere<br />
aus dem 16. und 17. Jahrhundert.<br />
„Von dem einen Hamburger Gängeviertel zu sprechen, ist<br />
falsch. Es gab Gängeviertel in weiten Teilen der Altstadt und<br />
der Neustadt“, erläutert der Regisseur und Produzent in einer<br />
Person. Die größtenteils eng mit Fachwerkhäusern bebauten<br />
Wohnquartiere entstanden im 16. und 17. Jahrhundert. Die<br />
Wohnungen waren oft nur durch schmale Gassen, labyrinthartige<br />
Hinterhöfe, Torwege und die namensgebenden verwinkelten<br />
Gänge zwischen den Häusern zu erreichen. Durch<br />
das Bevölkerungswachstum, das sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
enorm beschleunigte, wurden die Gängeviertel zum<br />
Zuhause von immer mehr in prekären Verhältnissen lebenden<br />
Menschen. Lebten 1852 zu Beginn der Industrialisierung<br />
noch rund 160.000 Menschen in der Hansestadt, so waren es<br />
1900 bereits mehr als 700.000. Die drangvolle Enge in den<br />
Elendsquartieren mit all den negativen Folgen nahm dementsprechend<br />
zu. Neben der Überbevölkerung war vor allem die<br />
Wasserver- und -entsorgung ein Riesen-Problem.<br />
An der Straße Pumpen in der Hamburger Altstadt standen<br />
die Wohnhäuser einst dicht an dicht. Das Quartier wurde<br />
für den Bau eines modernen Kontorhausvietrtels abgerissen.<br />
Foto: Staatsarchiv Hamburg<br />
Die Altstadt-Häuser an der Ecke Pumpen/Burchardstraße<br />
wurden abgerissen. Stattdessen wurde an der Stelle das<br />
Chilehaus gebaut, das Prunkstück des neuen Kontorhausviertels.<br />
Foto: Staatsarchiv Hamburg<br />
54<br />
Herbst 2023