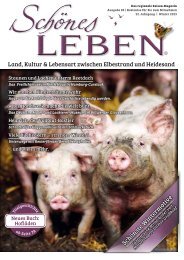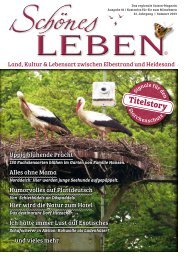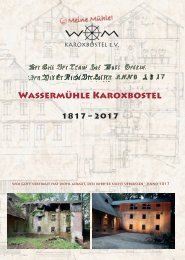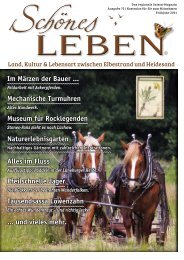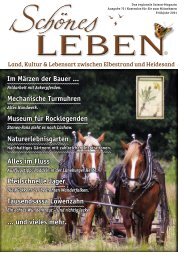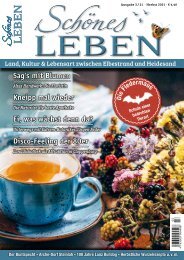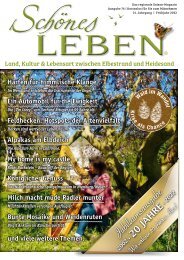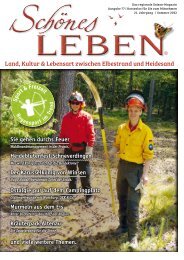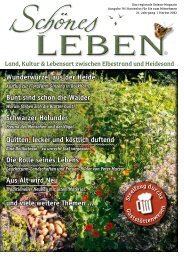SCHÖNES LEBEN – Ausgabe 82
Land, Kultur & Lebensart zwischen Elbestrand und Heidesand
Land, Kultur & Lebensart zwischen Elbestrand und Heidesand
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seitenansicht der St. Nicolai Kirche Altenbruch<br />
Doppelturm der St. Nicolai Kirche Altenbruch<br />
St. Jacobi Kirche Lüdingworth<br />
Die Kirche wurde um 1200 als Feldsteinkirche auf einer<br />
Wurt errichtet. Sie ist auch einer der drei sogenannten Bauerndome<br />
im ehemaligen Land Hadeln und wurde mehrfach<br />
im Laufe der Zeit umgestaltet, teilweise mit Backsteinen<br />
ausgebaut und mit mächtigen Strebepfeilern ergänzt. Ende<br />
des 16. Jahrhunderts erhielt sie eine reich bemalte Renaissance-<br />
Holzbalkendecke und im 17./18. Jahrhundert durch<br />
die Spenden der umliegenden Bauern eine in der Region<br />
einmalige Barock-Innenausstattung. So wurde 1774 im Auftrag<br />
drei reicher Bauern eine mit reichem Rokokoschnitzwerk<br />
ausgestattete Prieche (Empore) für ihre Familien errichtet.<br />
Dass die Kirche auch als Wehrkirche genutzt wurde, kann<br />
man an den Schießscharten am Turm erkennen. Der Turm<br />
mit seiner viereckigen Grundform endet über eine hölzerne<br />
Helmpyramide in einer achteckigen Spitze. Eine Besonderheit<br />
ist die Orgel mit dem größten geschlossenen Registerbestand<br />
der Renaissance in Deutschland. Gebaut von Antonius<br />
Wilde 1598/99 wurde sie 16<strong>82</strong>/83 von Arp Schnitger<br />
umgebaut und auf 35 Register erweitert.<br />
St. Nicolai Kirche Altenbruch<br />
Die St.-Nicolai-Kirche im Cuxhavener Stadtteil Altenbruch<br />
gehört zur evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde und ist<br />
der dritte Bauerndom im Land Hadeln. Sie steht auf einer<br />
flachen Landerhebung, einer Wurt, so dass sie bei Überflutungen<br />
meistens im Trockenen blieb und Menschen eine<br />
Zuflucht bot. Diese Landerhebung war von einem Graben<br />
umschlossen. Die erstmalige urkundliche Erwähnung stammt<br />
aus dem Jahre 1280. Das älteste bekannte Kirchensiegel ist<br />
aus dem Jahre 1333 und zeigt zwei sitzende Bischöfe. Die<br />
Vermutungen gehen dahin, dass damit der heilige Nikolaus<br />
und der heilige Willehad dargestellt werden sollen. Der eine<br />
ist der Namenspatron der Kirche und der Schutzpatron der<br />
Seefahrer, der andere der Missionar der Sachsenlande. Die<br />
Kirche ist ein einschiffiger Feldsteinbau mit Tonnengewölbe<br />
und Doppelturmfassade. Der Doppelturm war ein markantes<br />
Zeichen für die Seefahrt und ist auf allen alten Land- und<br />
Seekarten deutlich hervorgehoben. Der massiv gebaute Turm<br />
trennt sich oberhalb des Dachfirstes des Hauptgebäudes in<br />
zwei Einzeltürme, die im Volksmund die Namen Anna und<br />
Beate haben, die mit Kupfer gedeckt sind und eine Höhe von<br />
45 Metern aufweisen. 1493/94 wurde das Gebäude um einen<br />
Hallenchor erweitert, auf dessen Grundmauern wurde um<br />
1727/28 der Backsteinchor unter einem Mansarddach errichtet.<br />
Von dem ursprünglichen Feldsteinmauerwerk haben sich<br />
noch Teile z.B. am Ende des im 15. Jahrhundert ausgebesserten<br />
Schiff erhalten können. Auch im Schaft des Turmes<br />
sind noch Feldsteinreste zu finden. Auffallend ist die Größe<br />
des Chores und vor allem die Innenausstattung; sie spiegelt<br />
den Reichtum der Bauern in diesem Landstrich wider. Die<br />
Stundenglocke hängt im Südturm und ist von außen in einem<br />
Turmerker zu sehen. Das restliche Geläut dieser Kirche ist in<br />
einem hölzernen Glockenturm südlich des Doppelturms<br />
untergebracht. Dieser Holzturm wurde im Jahr 1647 erbaut<br />
und steht abgerückt vom Kirchengebäude, wodurch Übertragungen<br />
von Glockenschwingungen auf das Mauerwerk der<br />
Kirche und hieraus ggf. folgende Schäden vermieden wurden.<br />
Die Orgel in Altenbruch repräsentiert die norddeutsche<br />
Orgelbaukunst der letzten 500 Jahre, da sie Pfeifenwerk aus<br />
der Gotik, der Renaissance, der Barockzeit und dem 20. Jahrhundert<br />
enthält.<br />
Diese Beschreibungen mit weiteren Abbildungen sowie einer<br />
genauen Kartierung dieser und zahlreicher weiterer baukulturell<br />
interessanter Gebäude aus dem Elbe-Weser-Dreieck<br />
finden Sie auf der Website „Spur der Steine“ unter folgender<br />
Adresse: https://baukultur-entdecken.<br />
museen-stade.de<br />
72<br />
Herbst 2023