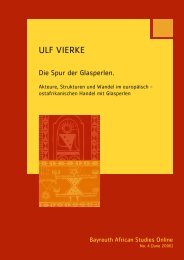Diplomarbeit - OPUS Bayreuth - Universität Bayreuth
Diplomarbeit - OPUS Bayreuth - Universität Bayreuth
Diplomarbeit - OPUS Bayreuth - Universität Bayreuth
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.4. SÄULENEXPERIMENTE<br />
Um für Säulenexperimente zeitlich hochaufgelöste Durchbruchskurven (DBK) aufnehmen<br />
zu können und den Experimentablauf zu variieren, schlägt Totsche [1998] folgenden<br />
Aufbau vor: Ein Fraktionssammler fängt das Säuleneluat auf. Pumpe und Fraktionssammler<br />
werden über eine Steuereinheit von einem Computer gesteuert, der gleichzeitig<br />
Meßdaten aufzeichnen kann. Innerhalb eines Experimentes lassen sich zum Beispiel die<br />
Zusammensetzung der Perkolationslösung, Temperatur oder Fließgeschwindigkeit ändern.<br />
Als besonders vielversprechend zur Abschätzung des immobilen bzw. an Wechselwirkungen<br />
unbeteiligten Porenwasseranteils beschreibt Totsche [1998] geschlossene Kreislaufexperimente.<br />
Bei derartigen geschlossenen Systemen ist eine zerstörungsfreie und den Experimentablauf<br />
nicht beeinflussende online-Analytik erforderlich. Studien zum PAK-Transport<br />
mit geschlossenen Kreislaufexperimenten sind wegen der Anforderungen an die Analytik<br />
nur schwer durchführbar.<br />
3.4.2 Identifizierung ratenlimitierter Stoffreisetzung<br />
Wichtig für alle Wechselwirkungen zwischen mobiler (Wasser) und immobiler Phase (Boden)<br />
ist die Aufenthaltsdauer oder Verweilzeit des Wassers. Chemische Reaktionen und<br />
Prozesse wie Diffusion oder Sorption sind zeitabhängig. Ist die Verweilzeit des Wassers<br />
kürzer als die Reaktionszeit, kann die Reaktion bzw. der Prozeß nicht vollständig ablaufen,<br />
es kann sich kein Gleichgewicht einstellen. Das Verhältnis von Reaktionszeitskala zu<br />
Transportzeitskala kann durch die von [Michalak und Kitanidis 2000, zit. in Wehrer und<br />
Totsche, 2003] eingeführte Damköhlerzahl beschrieben werden. Nach Wehrer und Totsche<br />
[2003] kann sie als Maß zur Optimierung von Säulenversuchen dienen.<br />
Da = LRk<br />
v<br />
Da: Damköhlerzahl [−]<br />
L: Säulenlänge [L]<br />
R: Retardationskoeffizient [−]<br />
k: Ratenparameter der Reaktion [T −1 ]<br />
v: Fließgeschwindigkeit (Abstandsgeschwindigkeit) im System [L T −1 ]<br />
(3.5)<br />
Brusseau et al. [1997] zeigten, daß Flußunterbrechungen zur Identifizierung von Ratenlimitierung<br />
bei der Stoffreisetzung beitragen können. Anhand numerischer Simulationen<br />
schlagen Wehrer und Totsche [2003] folgendes Experimentdesign zur Detektion von ratenlimitierter<br />
Freisetzung vor: Säulenexperimente mit mindestens 2 Parallelversuchen, wobei<br />
sich die Fließgeschwindigkeiten um den Faktor zehn unterscheiden sollen. Zudem sollte<br />
pro Fließgeschwindigkeit mindestens eine Flußunterbrechung erfolgen, sowie Messung der<br />
Effluentkonzentrationen direkt vor und nach der Flußunterbrechung. Bei ratenlimitierter<br />
Desorption von der Säulenfüllung sind nach einer Flußunterbrechung höhere Effluentkonzentrationen<br />
als vor der Flußunterbrechung zu erwarten, der Unterschied ist bei hohen<br />
Fließgeschwindigkeiten größer. Um Verfälschung der DBK durch Diffusion zu vermeiden,<br />
darf die Fließgeschwindigkeit nicht zu gering sein und die Flußunterbrechung nicht zu lange<br />
dauern. Möglich ist eine Vortäuschung ratenlimitierter Freisetzung durch Vorhandensein<br />
nicht am Transport beteiligter Regionen des Porenraumes (immobiles Wasser, 2-Regionen-<br />
System). Durch Aufnahme von DBK eines konservativen Tracers im Säulenversuch mit<br />
13