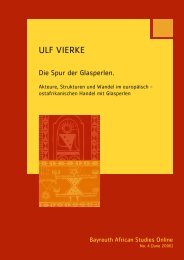Diplomarbeit - OPUS Bayreuth - Universität Bayreuth
Diplomarbeit - OPUS Bayreuth - Universität Bayreuth
Diplomarbeit - OPUS Bayreuth - Universität Bayreuth
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KAPITEL 5. MATERIAL UND METHODEN<br />
digung 2 des Säulenversuches möglich. Als Vergleichswert kann der mit Lysimetermaterial<br />
gewonnene Wert des Porenvolumens dienen. Umgerechnet auf ein Säulenvolumen von 1,064<br />
10 −3 m 3 ergibt sich ein PV von 3,34 10 −4 m 3 . Zu beachten ist jedoch, daß das im Lysimeter<br />
eingebaute Material weder gesiebt noch getrocknet wurde und beim Einbau mit<br />
höherer Energie verdichtet wurde als der Säuleninhalt.<br />
Tabelle 5.5: Kenngrößen der Säulenfüllung in Exp1 und Exp2<br />
Experiment ρnaß spezif. Poren- Substanz- eingebaute<br />
Poren- anteil dichte Trockenmasse<br />
volumen<br />
[kg m −3 ] [m 3 ] [%] [kg m −3 ] [kg]<br />
1 1649 4,56 10 −4 42,9 2136 1,298<br />
2 1694 4,42 10 −4 41,6 2207 1,372<br />
5.3.3 Experimentablauf<br />
Entsprechend meiner Hypothesen variiere ich die Parameter Fließgeschwindigkeit, Temperatur<br />
und Perkolationslösung. Die genaue Abfolge der Parameterveränderungen in den<br />
Säulenexperimenten ist Abb. 5.4 zu entnehmen.<br />
Fließgeschwindigkeit<br />
Bei der Auswahl der Fließgeschwindigkeit schlagen die Normen prEN14405 und ISO/<br />
TC190WG6 einen Wert von 15 ± 2cmd −1 (s.o.) vor, was umgerechnet auf das Säulenvolumen<br />
der von mir verwendeten Säulen sowie das tatsächliche PV des eingebauten<br />
Materials etwa 2,5 PV d −1 entspricht. Ich wähle für das erste Experiment (Exp1) jedoch<br />
eine Geschwindigkeit von 1,45 PV d −1 , um die Geschwindigkeit noch deutlich erhöhen zu<br />
können, aber mich nicht zu weit von der Empfehlung der Normen zu entfernen.<br />
Das zweite Experiment (Exp2) sollte ursprünglich mit fünffacher Geschwindigkeit von<br />
Exp1 laufen. Wehrer und Totsche [2003] empfehlen sogar zehnfache Unterschiede, allerdings<br />
ist bei derart hohen Geschwindigkeiten für die online-Analytik eine größere Menge<br />
SPE-Kartuschen erforderlich, als mir zur Verfügung stand (Sonderanfertigungen des Glasbläsers,<br />
Dauer mehrere Monate). Nach der Kreislaufphase von Exp2 zeigte sich, daß die<br />
Wasserleitfähigkeit der SPE-Kartuschen maximal die vierfache Geschwindigkeit von Exp1<br />
zuläßt, was 5,93 PV d −1 entspricht (vgl. 5.5.1). Flußunterbrechungen stellen ebenfalls eine<br />
Variation der Fließgeschwindigkeit dar. Nach Modellierung und Ergebnissen von Wehrer<br />
[2003,unv.] erscheinen mir Flußunterbrechungen von 88 h und 48 h als sinnvoll.<br />
2<br />
Zur Zeit des Druckes meiner Arbeit erfolgen noch Experimente unserer Arbeitsgruppe mit meinen<br />
Säulen<br />
26