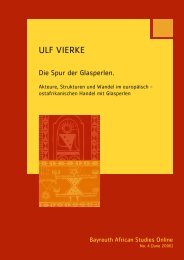Diplomarbeit - OPUS Bayreuth - Universität Bayreuth
Diplomarbeit - OPUS Bayreuth - Universität Bayreuth
Diplomarbeit - OPUS Bayreuth - Universität Bayreuth
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KAPITEL 5. MATERIAL UND METHODEN<br />
folgt ein dritter Extraktionsschritt nach obigem Muster. Nach dem letzten Trockenschritt<br />
werden Reste der Analyten mit 40 ml Lösemittelgemisch vom Na2SO4 entfernt. Am Rotationsverdampfer<br />
(Büchi Rotavapor R-144, Waterbath B-480; Kühlkreislauf Hauke DC10,<br />
K20; Membranpumpe Vacuubrand, Wertheim) wird das mit 100 µl Toluol als Keeper versetzte<br />
Filtrat bei 45 °C, 100 Umdrehungen pro Minute und schrittweisem Vakuum von 850<br />
bis 700 mbar auf 1 bis 2 ml eingeengt.<br />
Reinigung<br />
Unerwünschte Stoffe wie z.B. Säuren (polar) und Alkane (unpolar) aus dem eingeengten<br />
Filterextrakt, die zur Verschmutzung und Beschädigung der Säule des Gaschromatographen<br />
und des Massendetektors führen können, müssen durch Adsorbentien entfernt werden.<br />
Hierzu wird eine 8 ml Glassäule (Bakersystem) mit einem Glasfaserfilter (Chromabond,<br />
Fa. Macherey & Nagel für 6 ml Glassäulen, nominale Porengröße 1 µm) beschickt und<br />
zur Hälfte mit n-Hexan gefüllt. Darauf werden 750 mg Silica (Baker, 0,063-0,200 mm, 5%<br />
deaktiviert, s. unten) gegeben. Nach ca. 10 Minuten Quellzeit werden alle Luftblasen durch<br />
Rühren entfernt. Auf die nach einigem Spülen mit n-Hexan gerade Silicaoberfläche werden<br />
1000 mg Aluminiumoxid (Baker, 50-200 µm, 9% deaktiviert) aufgebracht. Die Deaktivierung<br />
erfolgt durch zwölfstündiges Trocknen des Adsorbens bei 250 °C und Versetzen mit<br />
einem bestimmten Gewichtsanteil Milliporewasser zur besseren Handhabbarkeit. Nach Ablassen<br />
des Lösemittels bis zur Oberkante des Alox wird das Extrakt quantitativ(3 Schritte<br />
mit insgesamt 1 ml n-Hexan) auf die Säule überführt und mit 2 ml n-Hexan nachgespült.<br />
Der erste Milliliter des Eluates enthält die Alkane und wird verworfen. Anschließend wird<br />
die Säule mit 8 ml n-Hexan:Dichlormethan 1+4 (V+V) in ein mit 100 µl Toluol gefülltes<br />
Zentrifugenröhrchen eluiert, dessen Inhalt unter vorsichtiger N2-Begasung auf ca. 100 µl<br />
eingeengt wird. Die so gewonnene Probe wird wie für die SPE beschrieben (5.5.1) quantitativüberführt<br />
und mit internem Standard versetzt.<br />
5.5.3 GC-MS<br />
PAK werden bedingt durch ihre Flüchtigkeit häufig mit einem Gaschromatographen - Massenspektrometer<br />
(GC-MS) gemessen. Bei wässrigen Proben bietet sich auch eine Messung<br />
mit dem Flüssigchromatographie - Massenspektrometer (LC-MS) an. Die Technik der LC-<br />
MS ist jedoch sehr aufwendig, bisher teurer und weniger erprobt als GC-MS. Einen Überblick<br />
über GC-MS gibt z.B. Oehme [1996]. Baars und Schaller [1994] beschreiben Lösungswege<br />
zur Fehlersuche. Die Funktionsweise des GC-MS werde ich kurz umreißen: Der eigentlichen<br />
Messung im Massenspektrometer geht eine Auftrennung nach physikalischen Eigenschaften<br />
(Siede-/Schmelzpunkt, Affinität zum Material der Säulenbeschichtung) in der<br />
Säule des Gaschromatographen voraus. Dies geschieht durch schrittweise Mobilisierung der<br />
in der Probe enthaltenen Verbindungen durch Veränderung von Druck, Temperatur und<br />
Strömungsgeschwindigkeit eines Trägergases (Temperaturprogramm). Im MS werden die<br />
aus der GC-Säule kommenden Analyten ionisiert und anschließend in überlagerten elektrischen<br />
und magnetischen Feldern nach ihrem Verhältnis von Masse zu Ladung getrennt.<br />
Der zeitliche Intensitätsverlauf einzelner Massen wird aufgezeichnet.<br />
Anhand von Standardlösungen wird die Zeit bestimmt, die ein Stoff von der Probenaufgabe<br />
bis zum Auftreten maximaler Intensität am Säulenausgang benötigt (Retentionszeit). Die<br />
Retentionszeit eines Stoffes ist bei gleichen Meßbedingungen konstant, eine Identifizierung<br />
einer unbekannten Substanz ist in Verbindung mit gleichzeitiger Ermittlung ihrer Masse<br />
bedingt möglich. Integration des Zeit-Intensitätsdiagrammes und Vergleich der so erhalte-<br />
40