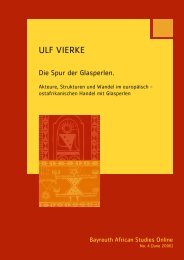Diplomarbeit - OPUS Bayreuth - Universität Bayreuth
Diplomarbeit - OPUS Bayreuth - Universität Bayreuth
Diplomarbeit - OPUS Bayreuth - Universität Bayreuth
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6.3. ERGEBNISSE DER SÄULENVERSUCHE<br />
verbleiben eher im Oberflächenfilm). Ein Teil der PAK wird wohl auch an den Säulenwänden,<br />
der porösen Platte und den Kapillaroberflächen sorbieren.<br />
Von Bedeutung für die Säulenexperimente ist die niedrige Wiederfindung beim Test des<br />
Aufbaus nicht. Bei den eigentlichen Säulenexperimenten liegt im wesentlichen ein 2-Phasen-<br />
System vor, Luft/Wassergrenzflächen treten nicht auf, es dominieren Wechselwirkungen<br />
zwischen Wasser und Partikeln (eventuell auch Mizellen). Durch die dem eigentlichen Säulenexperiment<br />
vorgeschaltete Kreislaufphase werden mögliche Adsorptionsstellen für PAK<br />
an Säulenwand und poröser Platte abgesättigt. Gegenüber den vom Bodenmaterial zur<br />
Verfügung gestellten Sorptionsplätzen dürfte die Zahl der Sorptionsplätze von Säule und<br />
poröser Platte gering sein.<br />
6.3 Ergebnisse der Säulenversuche<br />
6.3.1 Darstellung der Ergebnisse<br />
Bei Auftragung von tatsächlich perkolierten PV gegen Konzentration des Säuleneluates<br />
tritt durch die geringfügige Abweichung der Fließgeschwindigkeiten vom Sollwert eine Verschiebung<br />
von 0,5 PV über die gesamte Versuchsdauer auf. Da sich die Änderung der<br />
Randbedingungen am Sollwert der Fließgeschwindigkeiten orientierte, scheint sich z.B. die<br />
Temperaturerhöhung verzögert auszuwirken. Bei Darstellung von perkolierten PV gemäß<br />
Sollwert treten Änderungen der Randbedingungen in der Grafik zeitgleich auf und Exp1<br />
und Exp2 können besser verglichen werden. Ich bevorzuge zum Vergleich der beiden Experimente<br />
daher die Darstellung von dem Sollwert entsprechenden PV (Fehler konstant +2 %).<br />
Die Kreislaufphase (9 PV) ist nicht abgebildet, da in diesem Abschnitt des Experimentes<br />
keine Meßwerte gewonnen werden konnten.<br />
Um die Unterschiede zwischen Konzentrationsverlauf und Quellstärke zu verdeutlichen,<br />
stelle ich Abbildungen mit beiden Werten für ausgewählte PAK einander gegenüber. Da<br />
die Fließgeschwindigkeit in einem Experiment nur zwischen null (Flußunterbrechung) und<br />
einem festen Wert pendelt, ist die Quellstärke innerhalb eines Experimentes proportional<br />
zum Konzentrationsverlauf und verhält sich identisch, wenn von relativem Ansteigen oder<br />
Abfallen die Rede ist. Mit einem vertikalen Pfeil und STOPP sind die Flußunterbrechungen<br />
markiert, die Perkolation mit Millipore und der Temperaturwechsel mit horizontalen<br />
Pfeilen.<br />
6.3.2 Chlorid, pH, elektrische Leitfähigkeit: Offline Messungen<br />
Nach der Kreislaufphase sinkt die Chloridkonzentration in beiden Experimenten auf etwa<br />
ein Zehntel des Ausgangswertes (Abb. 6.9). Zur Aufnahme einer DBK wurde in Exp1<br />
nach 3 PV mit 0,02 molarer NaCl-Lösung perkoliert, was im weiteren Verlauf zu erhöhter<br />
Chloridkonzentration von Exp1 gegenüber Exp2 führt. Chlorid wird also gespeichert und<br />
langsam wieder freigesetzt (Retardation). Die Anfangskonzentration liegt nur eine Größenordnung<br />
unter der Konzentration der NaCl-Lösung. Kleinere Konzentrationserhöhungen<br />
(z.B. Exp1 zwischen den Flußunterbrechungen) zeichnen kurze, durch Wartungsarbeiten<br />
bedingte Flußunterbrechungen (