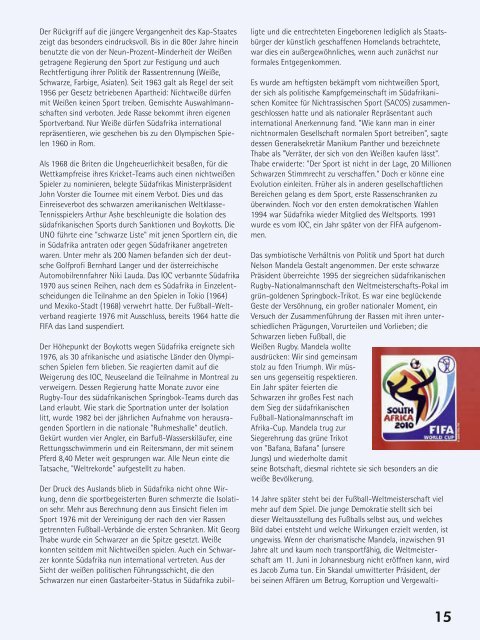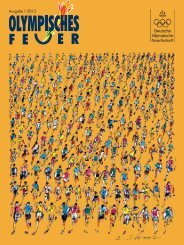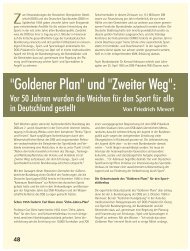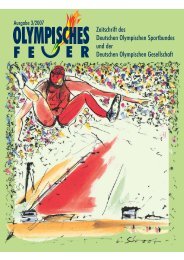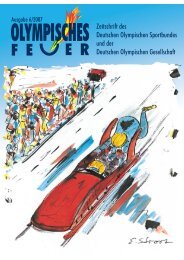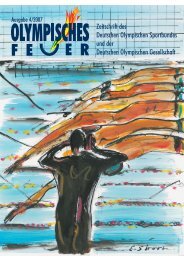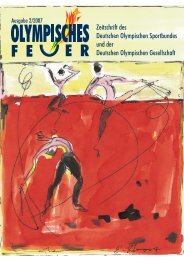Ausgabe 3/2010 - Deutsche Olympische Gesellschaft
Ausgabe 3/2010 - Deutsche Olympische Gesellschaft
Ausgabe 3/2010 - Deutsche Olympische Gesellschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der Rückgriff auf die jüngere Vergangenheit des Kap-Staates<br />
zeigt das besonders eindrucksvoll. Bis in die 80er Jahre hinein<br />
benutzte die von der Neun-Prozent-Minderheit der Weißen<br />
getragene Regierung den Sport zur Festigung und auch<br />
Rechtfertigung ihrer Politik der Rassentrennung (Weiße,<br />
Schwarze, Farbige, Asiaten). Seit 1963 galt als Regel der seit<br />
1956 per Gesetz betriebenen Apartheid: Nichtweiße dürfen<br />
mit Weißen keinen Sport treiben. Gemischte Auswahlmannschaften<br />
sind verboten. Jede Rasse bekommt ihren eigenen<br />
Sportverband. Nur Weiße dürfen Südafrika international<br />
repräsentieren, wie geschehen bis zu den <strong>Olympische</strong>n Spielen<br />
1960 in Rom.<br />
Als 1968 die Briten die Ungeheuerlichkeit besaßen, für die<br />
Wettkampfreise ihres Kricket-Teams auch einen nichtweißen<br />
Spieler zu nominieren, belegte Südafrikas Ministerpräsident<br />
John Vorster die Tournee mit einem Verbot. Dies und das<br />
Einreiseverbot des schwarzen amerikanischen Weltklasse-<br />
Tennisspielers Arthur Ashe beschleunigte die Isolation des<br />
südafrikanischen Sports durch Sanktionen und Boykotts. Die<br />
UNO führte eine "schwarze Liste" mit jenen Sportlern ein, die<br />
in Südafrika antraten oder gegen Südafrikaner angetreten<br />
waren. Unter mehr als 200 Namen befanden sich der deutsche<br />
Golfprofi Bernhard Langer und der österreichische<br />
Automobilrennfahrer Niki Lauda. Das IOC verbannte Südafrika<br />
1970 aus seinen Reihen, nach dem es Südafrika in Einzelentscheidungen<br />
die Teilnahme an den Spielen in Tokio (1964)<br />
und Mexiko-Stadt (1968) verwehrt hatte. Der Fußball-Weltverband<br />
reagierte 1976 mit Ausschluss, bereits 1964 hatte die<br />
FIFA das Land suspendiert.<br />
Der Höhepunkt der Boykotts wegen Südafrika ereignete sich<br />
1976, als 30 afrikanische und asiatische Länder den <strong>Olympische</strong>n<br />
Spielen fern blieben. Sie reagierten damit auf die<br />
Weigerung des IOC, Neuseeland die Teilnahme in Montreal zu<br />
verweigern. Dessen Regierung hatte Monate zuvor eine<br />
Rugby-Tour des südafrikanischen Springbok-Teams durch das<br />
Land erlaubt. Wie stark die Sportnation unter der Isolation<br />
litt, wurde 1982 bei der jährlichen Aufnahme von herausragenden<br />
Sportlern in die nationale "Ruhmeshalle" deutlich.<br />
Gekürt wurden vier Angler, ein Barfuß-Wasserskiläufer, eine<br />
Rettungsschwimmerin und ein Reitersmann, der mit seinem<br />
Pferd 8,40 Meter weit gesprungen war. Alle Neun einte die<br />
Tatsache, "Weltrekorde" aufgestellt zu haben.<br />
Der Druck des Auslands blieb in Südafrika nicht ohne Wirkung,<br />
denn die sportbegeisterten Buren schmerzte die Isolation<br />
sehr. Mehr aus Berechnung denn aus Einsicht fielen im<br />
Sport 1976 mit der Vereinigung der nach den vier Rassen<br />
getrennten Fußball-Verbände die ersten Schranken. Mit Georg<br />
Thabe wurde ein Schwarzer an die Spitze gesetzt. Weiße<br />
konnten seitdem mit Nichtweißen spielen. Auch ein Schwarzer<br />
konnte Südafrika nun international vertreten. Aus der<br />
Sicht der weißen politischen Führungsschicht, die den<br />
Schwarzen nur einen Gastarbeiter-Status in Südafrika zubil-<br />
ligte und die entrechteten Eingeborenen lediglich als Staatsbürger<br />
der künstlich geschaffenen Homelands betrachtete,<br />
war dies ein außergewöhnliches, wenn auch zunächst nur<br />
formales Entgegenkommen.<br />
Es wurde am heftigsten bekämpft vom nichtweißen Sport,<br />
der sich als politische Kampfgemeinschaft im Südafrikanischen<br />
Komitee für Nichtrassischen Sport (SACOS) zusammengeschlossen<br />
hatte und als nationaler Repräsentant auch<br />
international Anerkennung fand. "Wie kann man in einer<br />
nichtnormalen <strong>Gesellschaft</strong> normalen Sport betreiben", sagte<br />
dessen Generalsekretär Manikum Panther und bezeichnete<br />
Thabe als "Verräter, der sich von den Weißen kaufen lässt".<br />
Thabe erwiderte: "Der Sport ist nicht in der Lage, 20 Millionen<br />
Schwarzen Stimmrecht zu verschaffen." Doch er könne eine<br />
Evolution einleiten. Früher als in anderen gesellschaftlichen<br />
Bereichen gelang es dem Sport, erste Rassenschranken zu<br />
überwinden. Noch vor den ersten demokratischen Wahlen<br />
1994 war Südafrika wieder Mitglied des Weltsports. 1991<br />
wurde es vom IOC, ein Jahr später von der FIFA aufgenommen.<br />
Das symbiotische Verhältnis von Politik und Sport hat durch<br />
Nelson Mandela Gestalt angenommen. Der erste schwarze<br />
Präsident überreichte 1995 der siegreichen südafrikanischen<br />
Rugby-Nationalmannschaft den Weltmeisterschafts-Pokal im<br />
grün-goldenen Springbock-Trikot. Es war eine beglückende<br />
Geste der Versöhnung, ein großer nationaler Moment, ein<br />
Versuch der Zusammenführung der Rassen mit ihren unterschiedlichen<br />
Prägungen, Vorurteilen und Vorlieben; die<br />
Schwarzen lieben Fußball, die<br />
Weißen Rugby. Mandela wollte<br />
ausdrücken: Wir sind gemeinsam<br />
stolz au fden Triumph. Wir müssen<br />
uns gegenseitig respektieren.<br />
Ein Jahr später feierten die<br />
Schwarzen ihr großes Fest nach<br />
dem Sieg der südafrikanischen<br />
Fußball-Nationalmannschaft im<br />
Afrika-Cup. Mandela trug zur<br />
Siegerehrung das grüne Trikot<br />
von "Bafana, Bafana" (unsere<br />
Jungs) und wiederholte damit<br />
seine Botschaft, diesmal richtete sie sich besonders an die<br />
weiße Bevölkerung.<br />
14 Jahre später steht bei der Fußball-Weltmeisterschaft viel<br />
mehr auf dem Spiel. Die junge Demokratie stellt sich bei<br />
dieser Weltausstellung des Fußballs selbst aus, und welches<br />
Bild dabei entsteht und welche Wirkungen erzielt werden, ist<br />
ungewiss. Wenn der charismatische Mandela, inzwischen 91<br />
Jahre alt und kaum noch transportfähig, die Weltmeisterschaft<br />
am 11. Juni in Johannesburg nicht eröffnen kann, wird<br />
es Jacob Zuma tun. Ein Skandal umwitterter Präsident, der<br />
bei seinen Affären um Betrug, Korruption und Vergewalti-<br />
15