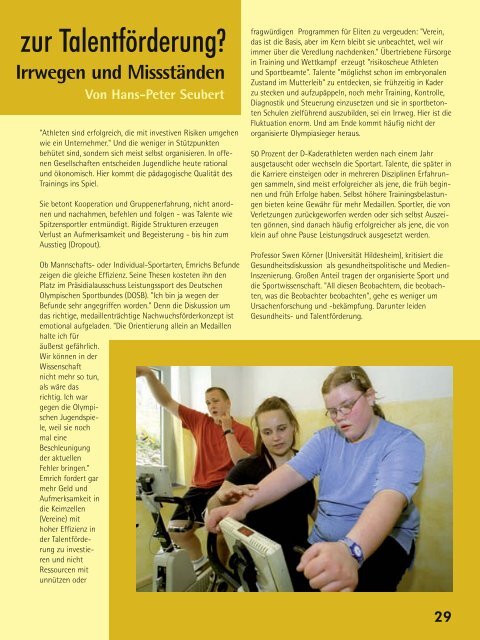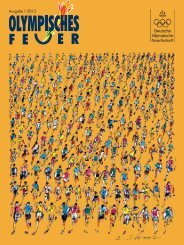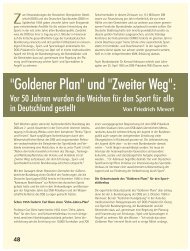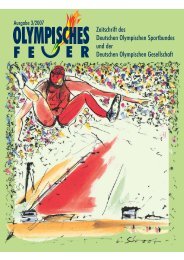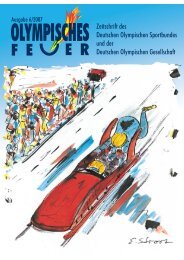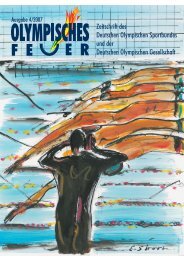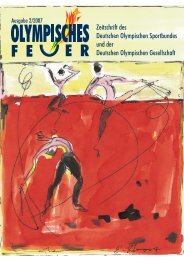Ausgabe 3/2010 - Deutsche Olympische Gesellschaft
Ausgabe 3/2010 - Deutsche Olympische Gesellschaft
Ausgabe 3/2010 - Deutsche Olympische Gesellschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zur Talentförderung?<br />
Irrwegen und Missständen<br />
Von Hans-Peter Seubert<br />
"Athleten sind erfolgreich, die mit investiven Risiken umgehen<br />
wie ein Unternehmer." Und die weniger in Stützpunkten<br />
behütet sind, sondern sich meist selbst organisieren. In offenen<br />
<strong>Gesellschaft</strong>en entscheiden Jugendliche heute rational<br />
und ökonomisch. Hier kommt die pädagogische Qualität des<br />
Trainings ins Spiel.<br />
Sie betont Kooperation und Gruppenerfahrung, nicht anordnen<br />
und nachahmen, befehlen und folgen - was Talente wie<br />
Spitzensportler entmündigt. Rigide Strukturen erzeugen<br />
Verlust an Aufmerksamkeit und Begeisterung - bis hin zum<br />
Ausstieg (Dropout).<br />
Ob Mannschafts- oder Individual-Sportarten, Emrichs Befunde<br />
zeigen die gleiche Effizienz. Seine Thesen kosteten ihn den<br />
Platz im Präsidialausschuss Leistungssport des <strong>Deutsche</strong>n<br />
<strong>Olympische</strong>n Sportbundes (DOSB). "Ich bin ja wegen der<br />
Befunde sehr angegriffen worden." Denn die Diskussion um<br />
das richtige, medaillenträchtige Nachwuchsförderkonzept ist<br />
emotional aufgeladen. "Die Orientierung allein an Medaillen<br />
halte ich für<br />
äußerst gefährlich.<br />
Wir können in der<br />
Wissenschaft<br />
nicht mehr so tun,<br />
als wäre das<br />
richtig. Ich war<br />
gegen die <strong>Olympische</strong>nJugendspiele,<br />
weil sie noch<br />
mal eine<br />
Beschleunigung<br />
der aktuellen<br />
Fehler bringen."<br />
Emrich fordert gar<br />
mehr Geld und<br />
Aufmerksamkeit in<br />
die Keimzellen<br />
(Vereine) mit<br />
hoher Effizienz in<br />
der Talentförderung<br />
zu investieren<br />
und nicht<br />
Ressourcen mit<br />
unnützen oder<br />
fragwürdigen Programmen für Eliten zu vergeuden: "Verein,<br />
das ist die Basis, aber im Kern bleibt sie unbeachtet, weil wir<br />
immer über die Veredlung nachdenken." Übertriebene Fürsorge<br />
in Training und Wettkampf erzeugt "risikoscheue Athleten<br />
und Sportbeamte". Talente "möglichst schon im embryonalen<br />
Zustand im Mutterleib" zu entdecken, sie frühzeitig in Kader<br />
zu stecken und aufzupäppeln, noch mehr Training, Kontrolle,<br />
Diagnostik und Steuerung einzusetzen und sie in sportbetonten<br />
Schulen zielführend auszubilden, sei ein Irrweg. Hier ist die<br />
Fluktuation enorm. Und am Ende kommt häufig nicht der<br />
organisierte Olympiasieger heraus.<br />
50 Prozent der D-Kaderathleten werden nach einem Jahr<br />
ausgetauscht oder wechseln die Sportart. Talente, die später in<br />
die Karriere einsteigen oder in mehreren Disziplinen Erfahrungen<br />
sammeln, sind meist erfolgreicher als jene, die früh beginnen<br />
und früh Erfolge haben. Selbst höhere Trainingsbelastungen<br />
bieten keine Gewähr für mehr Medaillen. Sportler, die von<br />
Verletzungen zurückgeworfen werden oder sich selbst Auszeiten<br />
gönnen, sind danach häufig erfolgreicher als jene, die von<br />
klein auf ohne Pause Leistungsdruck ausgesetzt werden.<br />
Professor Swen Körner (Universität Hildesheim), kritisiert die<br />
Gesundheitsdiskussion als gesundheitspolitische und Medien-<br />
Inszenierung. Großen Anteil tragen der organisierte Sport und<br />
die Sportwissenschaft. "All diesen Beobachtern, die beobachten,<br />
was die Beobachter beobachten", gehe es weniger um<br />
Ursachenforschung und -bekämpfung. Darunter leiden<br />
Gesundheits- und Talentförderung.<br />
29