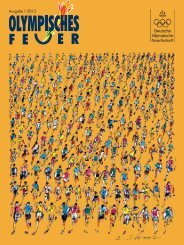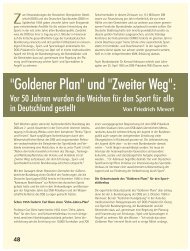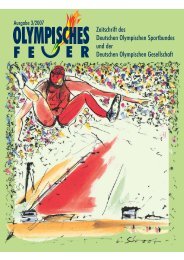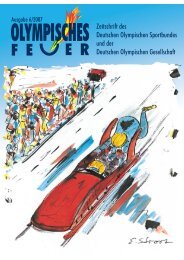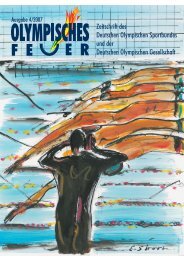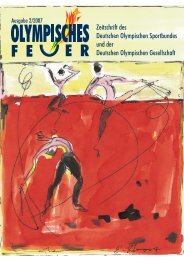Ausgabe 3/2010 - Deutsche Olympische Gesellschaft
Ausgabe 3/2010 - Deutsche Olympische Gesellschaft
Ausgabe 3/2010 - Deutsche Olympische Gesellschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bilder und stellte ein Ultimatum: Entweder Bau einer neuen<br />
Arena, oder keine WM in Kapstadt. Helen Zille musste klein<br />
beigeben - und rief bei der Stadioneröffnung Anfang des<br />
Jahres in Obama-Manier aus: "Yes, Afri-can!" Sie wurde zu<br />
einer Lehrstunde für politischen Pragmatismus durch eine<br />
Frau, die als führende weiße Oppositionspolitikerin inzwischen<br />
zur Premierministerin des Bundeslandes am Westkap<br />
aufgestiegen ist und nun den Eindruck erweckt, dass sich die<br />
420 Millionen Euro für das Prunkstück reichlich verzinsen<br />
werden.<br />
Der Doppelpass zwischen Politik und Sport wäre ohne Joseph<br />
Blatter nicht zustande gekommen. Eine gelungene Weltmeisterschaft<br />
wäre ein Triumph für den umstrittenen, eitlen,<br />
umtriebigen, widersprüchlichen FIFA-Präsidenten. Während<br />
das Internationale <strong>Olympische</strong> Komitee Afrika noch längst<br />
nicht für olympiatauglich hält, möchte sich der 74 Jahre alte<br />
Schweizer mit der WM ein Denkmal setzen. Der Anführer der<br />
populärsten Sportart ist ein Populist. Sein Spiel ist voller<br />
Finten und Raffinesse. Dabei gibt er sich gern als Staatsmann<br />
und als Missionar. Seine Ansprachen handeln von Verantwortung,<br />
Moral, Loyalität und Solidarität. Doch all zu oft ist es<br />
nur eine Solidarität des Geldes - oder leeres Gerede. Als vor<br />
einem Jahr eine vom Nobelpreiskomitee in Oslo und dem<br />
südafrikanischen Fußball-Verband nach Johannesburg einberufene<br />
"Friedenskonferenz" mit zahlreichen Nobelpreisträgern<br />
am Einreiseverbot für den Dalai Lama scheiterte, erhob sich<br />
weltweit ein Proteststurm. Die südafrikanische Regierung<br />
hatte sich dem Druck Chinas gebeugt. Blatter, der nicht müde<br />
wird, die Frieden stiftende, Rassenschranken überwindende<br />
Kraft des Fußballs zu rühmen, war stumm geblieben.<br />
Noch bevor der FIFA-Chef Südafrika für die WM <strong>2010</strong> durchgeboxt<br />
hatte, war klar, dass seine Organisation unabhängig<br />
von der Qualität des Weltchampionats ein sattes Geschäft<br />
machen würde. Fernsehen und Sponsoring bringen dem<br />
Fußball-Konzern 3,2 Milliarden Euro ein. Das macht gegenüber<br />
der WM in Deutschland eine Steigerungsrate von einer<br />
Milliarde Euro aus. Allein Europa, auf fast gleicher Zeitschiene<br />
gelegen wie Südafrika, zahlt der FIFA für die Live-Ware in<br />
Prime Time eine Milliarde Euro und damit doppelt soviel wie<br />
2006. Stolz ließ Fußball-Konzernchef Blatter jüngst verkünden,<br />
mit dem Gewinn aus dem vergangenen Jahr von 196<br />
Millionen Dollar seien die Rücklagen auf 1,059 Milliarden<br />
Dollar angewachsen.<br />
Einerseits ein Land der Armut, das unter den Belastungen<br />
dieser Weltmeisterschaft ächzt und als Einnahme nur den<br />
Entgelt aus knapp drei Millionen Eintrittskarten sicher hat; als<br />
Zuschuss kann Südafrika sicher nicht viel mehr erwarten als<br />
jene 105 Millionen Euro, die Blatters FIFA 2006 den deutschen<br />
Organisatoren gewährt hatte. Andererseits ein Sportverband<br />
als Geldmaschine, die ausgerechnet in Südafrika so<br />
produktiv wie nie arbeitet. So gehört zu den Wechselwirkungen<br />
zwischen Politik und Sport auch eine Art von gegenseitiger<br />
Ausbeutung.<br />
17