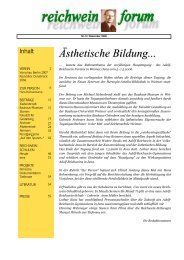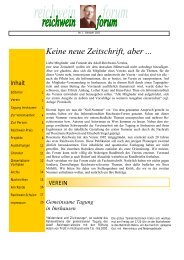„Richte immer die Gedanken... - Adolf-Reichwein-Verein
„Richte immer die Gedanken... - Adolf-Reichwein-Verein
„Richte immer die Gedanken... - Adolf-Reichwein-Verein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
· Susanne Wildhirt: Lehrstückunterricht<br />
gestalten. „Man müsste in <strong>die</strong> Flamme<br />
hineinschauen können“<br />
<strong>Reichwein</strong>s<br />
reformpädagogische<br />
Goethe-Schule<br />
in Tiefensee<br />
Ein Dank 41 an Heinz Schernikau für seinen<br />
tiefgründigen und hellsichtigen <strong>Reichwein</strong>-Aufschluss<br />
in seinem Buch:<br />
Tiefensee – ein Schulmodell aus dem<br />
Geist der deutschen Klassik. Reformpädagogik<br />
am Beispiel <strong>Adolf</strong> <strong>Reichwein</strong>s<br />
(2009)<br />
Hans Christoph Berg<br />
Einleitung mit einem Überblick über<br />
<strong>Reichwein</strong>s Schulbericht und einer<br />
Leseprobe aus Schernikaus Buch darüber<br />
2<br />
1. <strong>Adolf</strong> <strong>Reichwein</strong> hat 1937 seinen<br />
zweihundertseitigen Bericht über sei<br />
ne vierjährige Arbeit in Tiefensee vorgelegt:<br />
„Schaffendes Schulvolk"; anschaulich<br />
und gedankenreich, traditionskundig<br />
und aussichtsreich, zupackend<br />
und feinfühlig geschrieben –<br />
41 Es ist nach 25 Jahren ein zweiter Dank:<br />
„Zwar hat endlich Schernikau (1981) Herders<br />
Weltgeschichte und Humboldts Kosmos<br />
als curriculare Leitschriften des 19.<br />
Jahrhunderts dargestellt; aber meine drei<br />
Dauerfragen nach Lehrstücken und Lehrregeln<br />
im Traditionsstrom an meine Kollegen<br />
von der herrschenden Didaktik sind erst<br />
dann positiv beantwortet, wenn <strong>die</strong>se beiden<br />
Werke didaktisch kommentiert und<br />
sachlich novelliert in unsere Lehrerbildung<br />
eingebracht werden.“ (Berg: Lehrkunst im<br />
Traditionsstrom – dank Wagenschein,<br />
1986).<br />
2 In <strong>die</strong>ser Einleitung übernehme ich im Abschnitt<br />
1 <strong>die</strong> Einleitung aus meinem Nachwort<br />
zur <strong>Reichwein</strong>-Neuedition (1993,<br />
2 2009, mit dem Präludium Berg/Amlung<br />
1988), und im Abschnitt 2 <strong>die</strong> Ankündigung<br />
meiner Schernikau-Rezension im <strong>Reichwein</strong>-Forum<br />
Nr. 15/Juni 2010.<br />
reichwein forum Nr. 17/18 Mai 2012<br />
53<br />
(= Lehrkunstdidaktik, Band 2). hep,<br />
Bern 2008<br />
zugleich ein journalistisch gekonnter<br />
Schulreport wie ein pädagogischliterarisches<br />
Meisterstück, eines der<br />
paar Dutzend klassischen Meisterwerke<br />
der Pädagogik, in Art und Rang<br />
benachbart Pestalozzis Stanser Brief,<br />
Tolstojs Jasnaja Poljana und Neills<br />
Summerhill.<br />
Von den vier Kapiteln bringt das erste<br />
– „Von der Gestaltung" – <strong>die</strong> Grundlinien<br />
oder den Satz der siebenteiligen<br />
Regel, <strong>die</strong> sich in Analogie zur „Odenwald-Ordnung"<br />
(Wagenschein 42008)<br />
und zur „Salemer Regel" (Hahn 1986)<br />
vielleicht als „Tiefensee-Regel" zusammenfassen<br />
lassen. Die sieben Teilregeln<br />
sind: Selbsthilfe (1) und Gegenseitige<br />
Hilfe (2), Einleben in den natürlichen<br />
Kreislauf der Dinge (3) und<br />
Aneignung des maßgeblichen kulturellen<br />
Grundstocks (4), Sparsame Beschränkung<br />
(5) und Sachlichkeit (6),<br />
und alles gerichtet auf Werkschaffen<br />
(7). Beispielhaft kommt seine fünfte<br />
Regel – Sparsame Beschränkung:<br />
‚mach' möglichst viel aus möglichst<br />
wenig’ – in einem seiner Unterrichtsprojekte<br />
zum Ausdruck: „Das<br />
Glasdach stellte wieder neue eigenartige<br />
Anforderungen: viel Glas und wenig<br />
Holz war <strong>die</strong> Parole. Sämtliche<br />
Hausböden wurden durchstöbert, alles<br />
erreichbare Glas zusammengetragen,<br />
geschnitten, gefügt. Es gab nach<br />
Größe und Qualität der Stücke buntes<br />
Mosaik. Wir holten aus einem entfernten<br />
Dorfe Fenster, <strong>die</strong> bei der Erneuerung<br />
des Pfarrhauses überzählig<br />
geworden waren, wir suchten im Keller<br />
der Gärtnerei nach abgelegtem<br />
Bruch von Mistbeeten, kurz, wir bemühten<br />
uns um den Beweis, dass eine<br />
einsame, ländliche Schulgemeinschaft<br />
auch ohne fremde Geldhilfe, wenn sie<br />
nur erfinderisch ist, fast aus dem<br />
(3)<br />
· Vgl. Heinz Schernikau: Tiefenee –<br />
ein Schulmodell aus dem Geist der<br />
deutschen Klassik …, S. 281<br />
Nichts ihre Arbeitsmittel selbst gestalten<br />
und dabei vieles lernen kann, wofür<br />
ihr sonst <strong>die</strong> aus eigener Arbeit<br />
gewonnene Anschauung fehlte." (<br />
<strong>Reichwein</strong> 22009, S. 66; im Folgenden:<br />
R 66)<br />
Das zweite, umfangreichste Kapitel –<br />
„Wie wir es machen" – beschreibt <strong>die</strong><br />
sieben großen Vorhaben (oder Unterrichtsprojekte),<br />
so wie sie sich auch<br />
nach Jahrzehnten in der Erinnerung<br />
seiner Schüler an ihre schöne und ergiebige<br />
Schulzeit erhalten haben mögen:<br />
Bau eines Gewächshauses, Bau<br />
und Beobachtung eines Bienenstockes,<br />
Hausbau von der Steinzeit bis<br />
heute, Erdkunde (besonders Afrika)<br />
im Fliegen, Weihnachtsspiel, schließlich<br />
<strong>die</strong> beiden großen Fahrten nach<br />
Ostpreußen und nach Schleswig-<br />
Holstein. In <strong>die</strong>sen Vorhaben lässt er<br />
seine ganze Lehrkunst spielen: „Wir<br />
machen in unserer ländlichen Schulgemeinschaft<br />
aus der Not des Beieinanders<br />
aller Altersstufen eine Tugend.<br />
Es ist <strong>die</strong> Tugend des neuen,<br />
vom Kind und seiner Sache und nicht<br />
mehr aus der Zerrissenheit der Fächer<br />
bestimmten Unterrichts" (R 57). „Das<br />
Instrument aber zu spielen, ist eine<br />
Kunst, <strong>die</strong> mit dem Orgelspiel vergleichbar<br />
ist, wenn <strong>die</strong>ser gewiss<br />
mangelhafte Vergleich überhaupt erlaubt<br />
ist..." (R 58).<br />
Im dritten Kapitel – „Von den Einfachen<br />
Formen" – legt nun der meisterliche<br />
Unterrichtshandwerker, der<br />
Schulmeister <strong>Reichwein</strong> Rechenschaft<br />
darüber ab, wie er <strong>die</strong> schulische<br />
Kleinarbeit in <strong>die</strong> großen Vorhaben<br />
des Lehrkünstlers <strong>Reichwein</strong> eingebaut<br />
hat. Denn „...Aus dem Gefüge<br />
der Orgelpfeifen Musik zu gestalten,<br />
ist im hohen Sinne nur dem Künstler<br />
gegeben. Also wird unser Erzieher et-