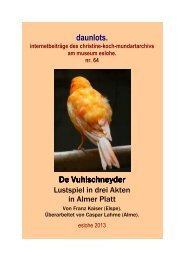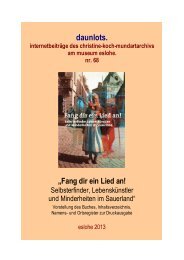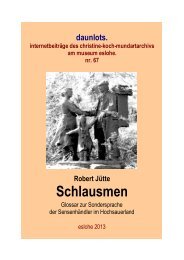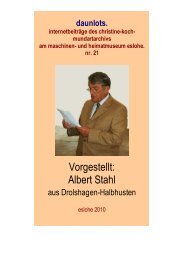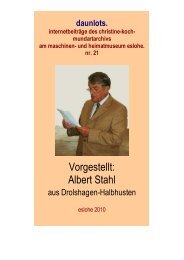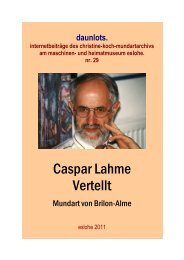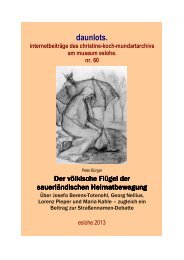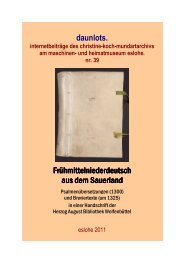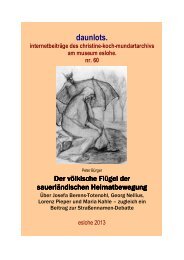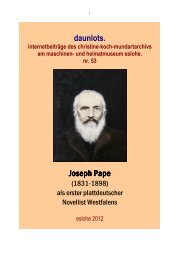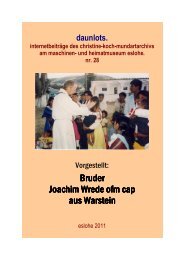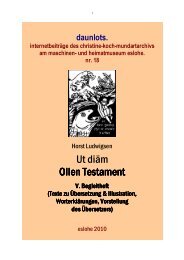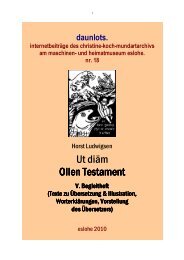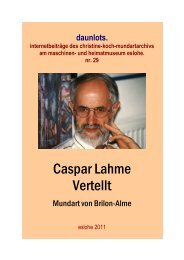Brauchtumslieder - Sauerlandmundart
Brauchtumslieder - Sauerlandmundart
Brauchtumslieder - Sauerlandmundart
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
11<br />
begrenzte Untersuchungen und Sammlungen vor 9 .<br />
Auch neuere Volksliedsammlungen berücksichtigen, wenn auch nur vereinzelt, die<br />
<strong>Brauchtumslieder</strong>. Davon seien hier nur zwei erwähnt: Das ist zum einen eine<br />
Kinderliedersammlung Fritz Jödes „Ringel, Rangel, Rosen“ 10 , dessen zweiter Teil<br />
unter dem Aspekt „Ansingelieder“ verfasst wurde, und zum anderen eine 1967<br />
erschienene Volksliedsammlung von Röhrich/Brednich 11 , in der die <strong>Brauchtumslieder</strong><br />
im II. Band ein eigenes Kapitel bilden.<br />
Bei der Suche nach Sekundärliteratur zum Thema „Brauchtumslied“ bekommt man<br />
schnell den Eindruck, als ob die Volksliedforschung über der Frage nach der<br />
Entstehung der Volkslieder einzelne Gattungen und besonders das Brauchtumslied<br />
fast gänzlich übersehen hätte. Wolfgang Suppan drückt dies folgendermaßen aus:<br />
„Als besonders geeigneter Ansatzpunkt für ...Untersuchungen bieten sich Balladen,<br />
Brauchtumsgesänge und geistliche Volkslieder an. Am wenigsten Beachtung fand<br />
darunter das Brauchtumslied.“ 12<br />
Den wichtigsten und ersten Beitrag zum Brauchtumslied lieferte Leopold Schmidt in<br />
einem 1940 erschienenen dreiseitigen Zeitungsaufsatz 13 . Auf die singuläre Stellung<br />
dieses Aufsatzes weist Suppan hin: „Zwar haben Erich Seemann und Walter Wiora<br />
den Volksliedbegriff bereits weiterentwickelt, doch ist für uns der Begriff der<br />
entschiedene Hinweis auf das Brauchtumslied von Wichtigkeit; dass niemand, auch<br />
Schmidt selbst nicht, an den schon 1940 gedruckten Aufsatz anknüpfte, ist<br />
erstaunlich.“ 14<br />
Inzwischen sind jedoch zwei wichtige Ergänzungsarbeiten erschienen. Die erstere<br />
behandelt die „Ansingelieder zu den Kalenderfesten“ 15 und ist als Habilitationsschrift<br />
1968 von Hinrich Siuts veröffentlicht worden. Den Hauptteil dieser Arbeit bilden<br />
9 z.B.:<br />
Kuckei, M.: Brauchtumspoesie aus Niederdeutschland, Garding, o.J.<br />
Weber, C.: Die Heischelieder an Fastnacht im Rheinland, (Diss. Köln 1930), Köln, 1933.<br />
Weber, H.: Die Hauptgruppe der rheinischen Maibräuche in kulturgeschichtlicher und<br />
kulturgeografischer Betrachtung, (Diss. Köln 1935), Köln, 1936.<br />
10 Jöde, F.(Hrsg.): Ringel, Rangel, Rosen, Spiel- und Ansingelieder für Haus, Kindergarten und<br />
Schule, Wolfenbüttel, o.J.<br />
11 Röhrich, L., Brednich, R.W.(Hrsg.): Deutsche Volkslieder, Düsseldorf, 1967.<br />
12 Suppan, W.: Melodiestrukturen im deutschsprachigen Brauchtumslied. In: Deutsches Jahrbuch<br />
für Volkskunde 19(1964), T.2, S. 254.<br />
13 Schmidt, L.: Das deutsche Brauchtumslied. Zum Volksliedbegriff der<br />
Volkskunde. In: Bayerische Hefte für Volkskunde 13(1940) S. 8-10.<br />
14 Suppan (wie Anm. 12), S. 255.<br />
15 Siuts, H.: Die Ansingelieder zu den Kalenderfesten. Ein Beitrag zur Geschichte, Biologie und<br />
Funktion des Volksliedes. Göttingen, 1968.